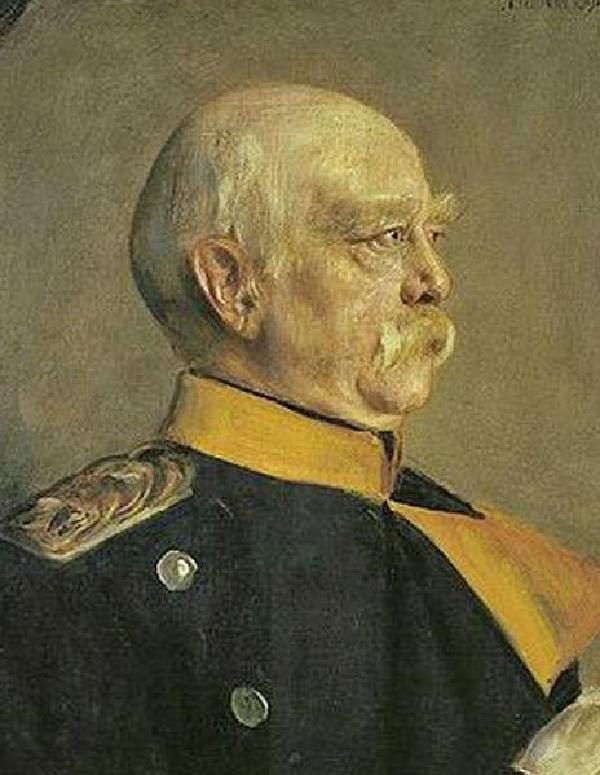Zu den Kapiteln
Schlagworte
Adolf Kempkes war ein Essener Rechtsanwalt, der als langjähriger Reichstagsabgeordneter und kurzzeitiger Staatsekretär zum engsten Führungskreis der nationalliberalen Deutschen Volkspartei gehörte.
Am 30.8.1871 kam Adolf Kempkes als ältester Sohn des aus Wesel zugezogenen Magazin-Verwalters und späteren Kaufmannes Bernhard Kempkes (geb. 1847) und der Essenerin Johanna geborene Kley (geb. 1847) in Essen zur Welt. Beide Eltern waren katholisch, hatten aber vermutlich erst einige Jahre nach der Geburt des Sohnes geheiratet. In seiner Geburtsstadt absolvierte er die Volksschule und das humanistische Königliche Gymnasium (heute Burggymnasium), an dem er 1891 das Abitur ablegte. 1891-1894 studierte er an den Universitäten Marburg, Freiburg und Berlin Rechtswissenschaften. Während dieser Zeit war er Korpsstudent. Nach dem Referendariat in Essen und Hannover und der Ablegung des zweiten Staatsexamens 1899 ließ er sich noch im selben Jahr an seinem Herkunftsort als Rechtsanwalt nieder.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg wurde er politisch in der Nationalliberalen Partei aktiv und saß für diese von 1906 bis zum Ende des Kaiserreiches in der Essener Stadtverordnetenversammlung. Zeitweise war er Vorsitzender des Jungliberalen Verbandes in Essen und in dieser Funktion Mitglied des rheinischen Provinzialvorstandes der Mutterpartei. Unmittelbar vor Kriegsausbruch nahm er die gleiche Funktion im Geschäftsführenden Ausschuss des westfälischen Provinzialverbandes der Nationalliberalen Partei ein, nachdem sich die Essener Nationalliberalen, an deren Spitze Kempkes jetzt stand, organisatorisch diesem angeschlossen hatten. Den Ersten Weltkrieg erlebte er als Offizier eines westfälischen Feldartillerieregiments.
Obwohl Kempkes als „Jungliberaler“ eher auf dem linken Flügel der Nationalliberalen Partei gestanden hatte, schloss er sich nach der Novemberrevolution nicht wie viele seiner jungliberalen Mitstreiter der Deutschen Demokratischen Partei (DDP), sondern der Deutschen Volkspartei (DVP) an, die Gustav Stresemann (1878-1929) nach der gescheiterten Fusion von Freisinn und Nationalliberalen im Dezember 1918 vor allem aus dem rechten Flügel der Nationalliberalen Partei gebildet hatte. Auf einer gemeinsamen Liste von DVP und Deutschnationaler Volkspartei (DNVP) für den Wahlkreis Düsseldorf-Ost wurde Kempkes im Januar 1919 als einer von nur 22 Volkspartei-Abgeordneten in die Deutsche Nationalversammlung gewählt; im letzten Reichstag des Kaiserreiches hatten die Nationalliberalen noch über 45 Mandate bei geringerer Gesamtzahl an Sitzen verfügt. Mit seiner Partei stand Kempkes zunächst in Opposition zur Regierung, die aus Sozialdemokraten, DDP und politischem Katholizismus als „Weimarer Koalition“ gebildet wurde.
Seine erste Plenarrede hielt er am 7.3.1919 zur Vorlage eines Sozialisierungsgesetzes, bei der Kempkes die Gefahren, die aus der Sozialisierung gerade zur jetzigen Zeit entstehen - gemeint war die wirtschaftliche Lage nach dem verlorenen Weltkrieg - herausstellte. Nicht nur deshalb galt Kempkes allgemein als der Industrie „nahestehend“ (Lothar Albertin). Er hatte zuvor als Anwalt Interessen der Essener Industrie vertreten.
Auch sein zweiter größerer Auftritt als Plenarredner galt Wirtschafts- beziehungsweise Finanzthemen. Ende 1919 kritisierte er vehement die vor allem von Reichsfinanzminister Mathias Erzberger (1875-1921) vorangetriebenen Pläne einer Luxussteuer und eines Reichsnotopfers zur Deckung der kriegsbedingten Finanznot. Danach ist Kempkes allerdings kaum noch im Plenum aufgetreten. Obwohl er im Juni 1920, im Mai und Dezember 1924 jeweils im Wahlkreis Düsseldorf-Ost, der auch Essen einschloss, sowie im Mai 1928 auf der Reichsliste der DVP wiederum in den Reichstag gewählt wurde, hat er als Redner nach September 1923 nicht mehr interveniert. Das Parlamentsplenum gehörte nicht zu seiner bevorzugten politischen Arena.
Ganz anders verhielt es sich mit den „Hinterzimmern“ der parteiinternen und zwischenparteilichen Debatten, wie später ein Nachruf auf Kempkes festhalten sollte: „Er war der Generalstabschef der Partei, der die Vertraulichkeit des stillen Beratungszimmers vorzog.“ (Vossische Zeitung) In der Tat war Kempkes schon bald eine Art „Graue Eminenz“ in seiner Partei: Ende 1919 wurde er deren Schatzmeister; 1920 übernahm er den Vorsitz im Geschäftsführenden Ausschuss der DVP, dem eigentlichen Entscheidungszentrum der Partei, da der formal übergeordnete Zentralvorstand aufgrund seiner Größe selten zusammentrat und sehr schwerfällig war. Auch weiteren wichtigen Parteigremien sowie dem Vorstand der Reichstagsfraktion gehörte Kempkes über lange Jahre an und leitete zudem als oberster hauptamtlicher Mitarbeiter die Reichsgeschäftsstelle der Partei. Nicht von ungefähr bezeichnete ihn der DVP-Vorsitzende Stresemann als „geschäftsführenden Parteivorsitzenden“.
Kempkes nutzte seine zentrale innerparteiliche Stellung aber nicht dazu, um seine eigene Karriere zu befördern. Vielmehr sah er seine eigentliche Aufgabe darin, seinen Vorsitzenden zu unterstützen und ihm den Rücken gegenüber den zahlreichen innerparteilichen Gegnern freizuhalten. Bis zum Tod Stresemanns im Oktober 1929 ist Kempkes dessen Kurs fast bedingungslos gefolgt: Er stimmte in der Nationalversammlung gegen den Versailler Vertrag und die Weimarer Reichsverfassung. Wie Stresemann schwankte er beim Kapp-Putsch im März 1920 zwischen Unterstützung und Distanzierung. Ursprünglich ein Verfechter einer engen Zusammenarbeit mit den Deutschnationalen, die er im Westen Deutschlands für unverzichtbar hielt, trat er bald für eine klare Abgrenzung gegenüber der Rechtspartei ein. 1928 unterstützte er Stresemann, der als Außenminister quasi im Alleingang eine Neuauflage der Großen Koalition gegen erbitterten innerparteilichen Widerstand durchsetzte, an der Kempkes auch nach dem Tod des Parteivorsitzenden bis zuletzt festhielt.
So erwies sich schon schnell Stresemanns Verzicht auf den geschäftsführenden Vorsitz als „Glücksgriff“ für ihn: „Kempkes war aufgrund seiner irenischen Art geradezu ideal geeignet, zwischen der Partei und Stresemann zu vermitteln.“ (Ludwig Richter) Für sein zweites Kabinett machte Stresemann seinen Vertrauten im Oktober 1923 zum Staatssekretär in der Reichskanzlei, vor allem um die eigene Fraktion auf Kurs der Großen Koalition zu halten.
Allerdings zermürbten diese Behauptungsversuche augenscheinlich Kempkes psychisch und körperlich; mehrfach konnte er nur mit Mühe von Stresemann zum Weitermachen ermuntert werden. Andererseits zog Stresemann Kempkes ins Vertrauen, als er Anfang 1929 seinerseits mit einem politischen Rückzug liebäugelte, woraufhin Kempkes von einer nicht zu übertreffenden Undankbarkeit einer Partei, die Ihnen alles verdankt sprach.
Mit Stresemanns Tod verlor Kempkes nicht nur seinen politischen Fixpunkt, sondern auch seinen innerparteilichen Rückhalt: Zwar schlug er selbst im Dezember 1929 den DVP-Fraktionsvorsitzenden Ernst Scholz (1874-1932) als Stresemanns Nachfolger an der Parteispitze vor, wurde aber bald darauf, da sich nun Partei- und Fraktionsvorsitz erstmals in einer Hand befanden, faktisch entmachtet. Für die Reichstagswahl im September 1930 erhielt er keinen sicheren Listenplatz mehr und kurz darauf gab er – formal aus „persönlichen Gründen“ – seine Position im Geschäftsführenden Ausschuss der Partei auf. Wenig später erlag Adolf Kempkes nicht einmal 60-jährig am 6.1.1931 in Berlin einem Herzschlag, gesundheitlich ein Opfer der innerparteilichen Grabenkämpfe, wie sein Kölner Parteikollege Paul Moldenhauer (1877-1947) wohl nicht zu Unrecht vermutete.
Über sein Leben jenseits der Politik ist kaum etwas überliefert, er war seit 1899 mit Anna, geborene Boos verheiratet – die Ehe blieb offenbar kinderlos – und seinem ehemaligen Gymnasium lebenslang verbunden. Bezeichnenderweise ist auch die einzige bekannte größere Publikation von Adolf Kempkes ein Buch über „seine“ DVP, das er zum 70. Jahrestag der Gründung der Nationalliberalen Partei herausgab, in deren Tradition sich die DVP nach wie vor selbst sah. Dazu steuerte er selbst einen Beitrag über die „Organisation der DVP“ bei. Lange Jahre war er Mitglied der Freimaurer Loge „Alfred zur Linde im Orient Essen“, wo er die Position eines „Redners“ und dann des „Zugeordneten Meisters“, also des stellvertretenden Vorsitzenden, einnahm.
Trotz seiner Verortung im „Rheinisch-Westfälischen“ und seiner Industrienähe gehörte Kempkes nicht jenem, genau von diesen Kreisen unterstützen rechten, DNVP-nahen Flügel der DVP an, der Stresemann das Leben lange Zeit schwermachte und nach seinem Tod faktisch die Macht in der Partei übernahm. Vielmehr lässt sich an der politischen Biographie Adolf Kempkes sehr gut jener Weg vom anfänglichen Skeptiker zum Verteidiger der republikanisch-demokratischen Ordnung nachzeichnen, den auch Kempkes‘ großes Vorbild Stresemann gegangen ist.
Werke
(Hg.), Deutscher Aufbau. Nationalliberale Arbeit der Deutschen Volkspartei, Berlin 1927.
Literatur
Albertin, Lothar, Liberalismus und Demokratie am Anfang der Weimarer Republik, Düsseldorf 1972.
Dickhoff, Erwin, Essener Köpfe. Wer war was? Essen 1985, S. 119.
Kolb, Eberhard/Richter, Ludwig (Hg.), Nationalliberalismus in der Weimarer Republik. Die Führungsgremien der Deutschen Volkspartei, Düsseldorf 1999.
Organisationshandbuch der Nationalliberalen Partei, Berlin 1907 u. 1914.
Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft, Band 1, Berlin 1930, S. 909.
Richter, Ludwig, Die Deutsche Volkspartei 1918-1933, Düsseldorf 2002.
Schulte, W., Adolf Kempkes †, in: Akropolis. Zeitschrift des Staatlichen Burggymnasiums in Essen (1931), S. 1.
Online
Nachruf in der Vossischen Zeitung v. 7.1.1931. [online]
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.
Frölich, Jürgen, Adolf Kempkes, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/adolf-kempkes/DE-2086/lido/5e8850021374e7.47760480 (abgerufen am 25.04.2024)