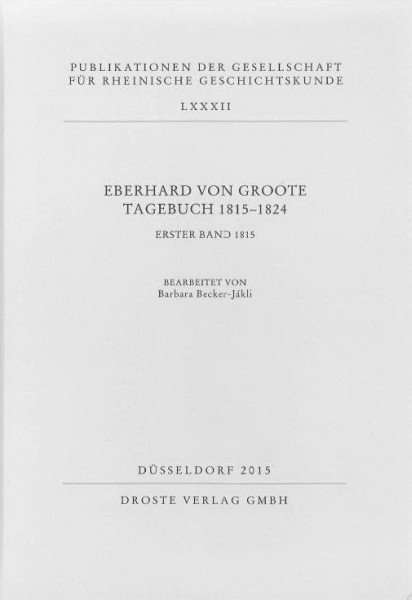Epochen
Der ansprechend und mit dokumentarischer Gründlichkeit gestaltete Band erlaubt in einer vorbildlich historisch-kritischen Edition ganz erstaunliche Einblicke und Einsichten in die Lebensumstände eines rheinischen Adeligen und damit ins wenig beschauliche vormärzliche Biedermeier. Das Konzept des Werks dokumentiert sich in dem hier behandelten ersten Band, dem weitere folgen sollen.
In der ausführlichen - 34 Seiten umfassenden - Einleitung zeichnet die Herausgeberin zunächst anhand der umfangreich vorhandenen Literatur das Leben des Kölner Adeligen Eberhard von Groote nach, wobei sie lobenswerterweise auf eine breite Darstellung dessen Lebensleistung verzichtet.
Eberhard Edler von Groote zu Kendenich nahm in der Geschichte Kölns zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine herausragende Rolle ein. Er entstammte einer alten, bereits Mitte des 16. Jahrhunderts aus Flandern emigrierten Adelsfamilie, die sowohl durch wirtschaftliche Potenz als auch politisches Engagement die Geschicke ihrer neuen Heimatstadt Köln mitbestimmte und im Sinne ihres katholisch-aristokratischen Sittenkodex soziale Verantwortung durch großzügige Stiftungen im kirchlichen und kulturellen Bereich bewies. Geboren im Jahr der Französischen Revolution 1789, verbrachte Groote seine frühe Kindheit in Köln, bevor sich seine Mutter und die Geschwister mitsamt einer ansehnlichen Dienerschaft auf Anordnung des Vaters, vor der französischen Besatzung fliehend, 1794 ins kurkölnische Arnsberg begaben. Nach seiner Rückkehr im Jahre 1802 besuchte Eberhard von Groote im Anschluss an die Privatausbildung durch einen geistlichen Hauslehrer von 1807 an die Sekundarschule, studierte ab 1809 in Köln und Heidelberg Rechts- und Geisteswissenschaften (ohne Promotionsabschluss!) und verfasste im Anschluss an sein Studium etliche Werke philosophischen und poetischen Charakters. Seine schriftstellerischen und philologischen Interessen, die er bis zum Lebensende verfolgte, führten unter anderem zu den Editionen von Gottfrieds von Straßburg Tristan mit der Fortsetzung Ulrichs von Türheim (1816–1821), Pleiers Tandareis und Flordibel (1827) und Des Meisters Godefrit Hagen Reimchronik der Stadt Köln aus dem 13. Jahrhundert (1834), die ihm im letztgenannten Jahr die Ehrendoktorwürde der Universität Bonn einbrachten. Weitere Editionen folgten, wie die Lieder Muskatblut’s (1853), Wierstraats Reimchronik der Stadt Neuss (1855) und die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff (1860), alle drei bis heute noch die maßgeblichen Editionen der betreffenden Texte bzw. Textœuvres. Daneben brachte Groote immer wieder eigene Dichtung hervor, wie 1824 das von Friedrich Schneider vertonte Oratorium Die Sündfluth.
Die für Groote einschneidenste Phase seines Lebens, für die er gerühmt wurde, die ihm aber gleichwohl nicht die Chance auf eine Anstellung im Staatsdienst und deswegen manche Verbitterung brachte, war sein „Feldzug 1815“, d.h. die Teilnahme als Freiwilliger am zweiten Frankreichfeldzug der Preußischen Armee, einschließlich der Besetzung von Paris. Dabei durfte er sich – von ihm selbst fast unbemerkt – zu den Siegern von Waterloo zählen, was nicht nur seinen Patriotismus befriedigte, sondern ihm auch Gelegenheit verschaffte, mit einer eigens von Blücher ausgestellten Vollmacht die von den französischen Truppen zuvor konfiszierten Kunstschätze nach Köln zurückzuholen. Der berühmteste dieser Schätze war Rubens‘ Kreuzigung Petri; das Gemälde konnte in einer Art Triumphzug nach Köln ge-bracht werden. Während dieser Zeit gewann Groote – ganz im Sinne seiner Standesbewusstheit – sogar die Nähe zum preußischen Kronprinzen, dem späteren König Friedrich Wilhelm IV. Auf kommunaler Ebene musste er manche herbe Niederlage einstecken. So waren weder seine in mehreren Streitschriften geäußerten Bemühungen für eine Neugründung der Kölner Universität noch seine Bestrebungen, eine Kunstsammlung in Köln einzurichten, von Erfolg gekrönt. Auch gelang ihm weder ein beruflicher Aufstieg bei der Kölner Regierung noch das Amt des Kölner Oberbürgermeisters, das einige seiner Vorfahren innehatten. Immerhin war er zwischen 1826 und 1845 Abgeordneter des Rheinischen Landtags, seit 1831 zudem Stadtrat in Köln und übernahm im selben Jahr die wohl einflussreichste seiner vielen öffentlichen Aufgaben, nämlich die Präsidentschaft der Kölner Armenverwaltung, die ihn zu der fürsorglichen Schrift „Das Waisenhaus zu Köln am Rheine“ veranlasste (1835). In dieser Periode war er darüber hinaus maßgeblich an Gründung und Entwicklung des Kölnischen Kunstvereins (1839) und des Kölner Zentral-Dombauvereins (1842) beteiligt.
Der Einleitung der Edition folgt als Schwerpunkt der Arbeit das Tagebuch von 1815, aufgeteilt in drei Abschnitte, denen jeweils Vorbemerkungen zum besseren Verständnis vorangehen. Sieht man von den vielen Trivialitäten bei den Tagebucheintragungen (z.B. „ Ich gehe spaziren/ zum Conzert/ bald zu Tisch“, „Nach Tisch gehe ich …“, „Ich bleibe zu Hause“, „Ich schreibe meine Briefe zurecht“, „Mir ist unwohl/ hypochondrich“) ab, die zu lesen man schon Interesse haben muss, so bietet sich dem Leser eine eindrucksvolle Schilderung der Vorgänge im besetzten Paris. Die Anmerkungen zum Tagebuch sind wissenschaftlich sehr sorgfältig mit recht detaillierten Personenangaben gehalten, wobei verständlicherweise nicht alle Namen identifiziert werden konnten.
Dem Hauptteil der Arbeit folgen in inhaltlichem Zusammenhang mit dem Tagebuch stehende „Briefe und Schriften“, die Groote im Laufe des Jahres 1815 geschrieben hat. Literaturverzeichnis, Orts- und Personenregister runden das gelungene Werk ab, wobei das umfangreiche Personenregister die Arbeit zu einer, bei solchen Anlässen immer gern apostrophierten, „Fundgrube“ macht, als die man sie wird nützen können. Den Abschluss bilden fünf Reproduktionen aus dem Tagebuch.
Es bleibt zu wünschen, dass auch die noch ausstehenden Bände bald zu Veröffentlichung gelangen.
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.
Spiertz, Willi, Becker-Jákli, Barbara (Bearb.), Eberhard von Groote. Tagebuch 1815–1824. Erster Band 1815 (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 82), Düsseldorf 2015, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Verzeichnisse/Literaturschau/becker-j%25C3%25A1kli-barbara-bearb.-eberhard-von-groote.-tagebuch-1815%25E2%2580%25931824.-erster-band-1815-publikationen-der-gesellschaft-fuer-rheinische-geschichtskunde-82-duesseldorf-2015/DE-2086/lido/57d26312ee0fd8.23147563 (abgerufen am 25.04.2024)