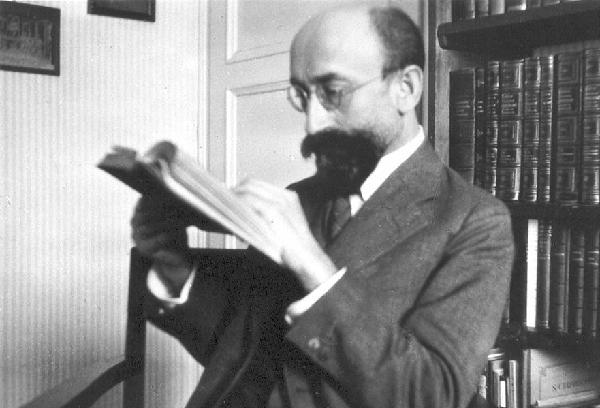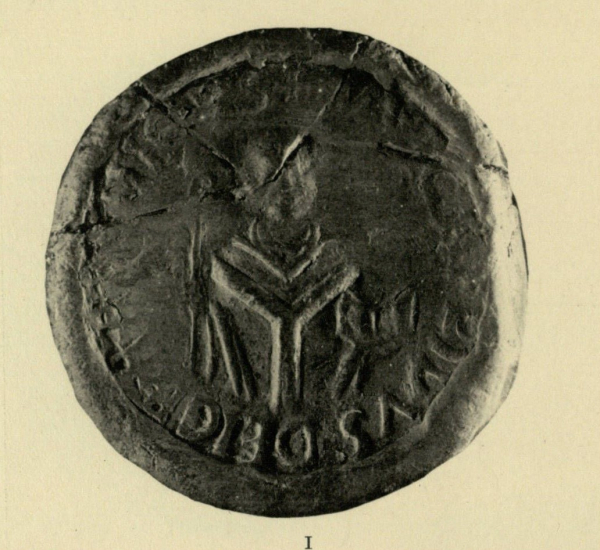Zu den Kapiteln
Schlagworte
Rudolf Schieffer gehörte zu den herausragenden Mittelalterhistorikern seiner Generation, dessen beeindruckend umfangreiches und fachlich breites Œuvre sich gleichermaßen durch tiefschürfende Detailstudien wie auch durch Gesamtdarstellungen und Editionen auszeichnet. Als Präsident der Monumenta Germaniae historica (MGH) und Mitglied in zahlreichen nationalen und internationalen Leitungsgremien, Akademien und wissenschaftlichen Gesellschaften sowie als gesuchter Gutachter wirkte er nachhaltig für das Fach, als erfolgreicher Vortragender auch für eine breitere Öffentlichkeit nach außen.
Rudolf Schieffer wurde am 31.1.1947 in Mainz als Sohn des Universitätsprofessors Theodor Schieffer (1910-1992) und dessen Ehefrau Anneliese, geborene Schreibmayr (1915-1981), geboren. Er hatte zwei Schwestern: Agnes (geboren 1948) und Elisabeth (geboren 1951). Der familiäre akademische und katholische Hintergrund prägten Schieffers Jugend. 1954 zog die Familie von Mainz nach Bad Godesberg (heute Stadt Bonn), wo er das renommierte Aloisiuskolleg der Jesuiten besuchte. Nach eigenem Bekunden war er ein sehr guter Schüler – mit Ausnahme der Fächer Musik und Sport, und tatsächlich hat sich bei ihm zeitlebens eine gewisse Indifferenz in dieser Richtung erhalten. Schieffer lebte für seine Wissenschaft und deren Institutionen und fand darin sein Genügen. Schon als Schüler half er seinem Vater, der an der Universität Köln mittelalterliche Geschichte lehrte, beim Kollationieren von Handschriften und lernte im Elternhaus nicht wenige Koryphäen des Fachs persönlich kennen. In Bonn und für ein Semester in Marburg studierte er 1966-1971 Geschichte und Lateinische Philologie. Dabei zeigte er zunächst starke Neigungen zur Alten Geschichte, wandte sich dann aber trotz der Profession des Vaters der Mediävistik zu, weil er dort sein Interesse an der Kirchengeschichte am besten glaubte stillen zu können. Seine Lehrer in Bonn waren insbesondere der Althistoriker Johannes Straub (1912-1996), der Mittellateiner Dieter Schaller (1929-2003) und der Mediävist Eugen Ewig (1913-2006), in Marburg der Mediävist Walter Schlesinger (1908-1984).
Bereits im Jahr seines Staatsexamens (1971) veröffentlichte er nicht weniger als vier Aufsätze in namhaften Fachzeitschriften, sechs weitere bis zur Promotion (1975) sowie einen ersten Band des Generalindex zur Ausgabe der Ökumenischen Konzilien seines Lehrers Straub. Die parallel erarbeitete Dissertation über „Die Entstehung von Domkapiteln in Deutschland“ beschrieb regional vergleichend den Weg monastisch geprägter Klerikergemeinschaften bis zu ihrer Institutionalisierung. Die Arbeit war ein großer Wurf, die Schieffers Doktorvater Eugen Ewig mit der von ihm nur zweimal vergebenen Bestnote bewertete, und spätestens jetzt wurde dem „jungen Schieffer“, wie er genannt wurde, eine glänzende akademische Zukunft prophezeit.
Unter mehreren ehrenvollen Angeboten nahm er zunächst 1975 die Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters bei den MGH in München an, wo ihn Horst Fuhrmann (1926-2010) mit der verwaisten Edition der Briefe Hinkmars von Reims betraute. Parallel arbeitete Schieffer an seiner Habilitationschrift über „Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den deutschen König“, die er in nur dreieinhalb Jahren fertigstellte und in Regensburg einreichte (1979). Sein Nachweis, dass das Investiturverbot keineswegs ursächlich für das Zerwürfnis zwischen Papst und Kaiser im sogenannten „Investiturstreit“ war, ließ den tieferliegenden Antagonismus zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt umso deutlicher hervortreten, dessen Auswirkungen Schieffer selbst als „papstgeschichtliche Wende“ thematisierte. Parallel dazu hatte er ein für den Druck eingereichtes Editions-Manuskript von Hinkmars berühmtem Traktat „De ordine palatii“ grundlegend überarbeitet.
Eine solch hohe Arbeitsbelastung hat Schieffer zeitlebens beibehalten, wozu seit seiner Berufung auf den Bonner Lehrstuhl seines Lehrers Ewig 1980 – im Alter von nur 33 Jahren – eine höchst erfolgreiche Lehre und vielerlei Verpflichtungen in Gremien und Beiräten sowie als Gutachter kamen. Schieffers Bonner Überblicksvorlesungen zum frühen und hohen Mittelalter waren legendär, weil sie mit stupender Sachkenntnis komplizierte Sachverhalte und Zusammenhänge klar gegliedert und in druckreifen Formulierungen darboten. Gleiches galt für seine Darstellungen, etwa zur Karolingerzeit, zur späten Salierzeit oder in dem zuletzt (2013) erschienenen Band „Christianisierung und Reichsbildungen, Europa 700-1200“, der exemplarisch die Arbeits- und Interessengebiete Schieffers spiegelt.
In seinen Seminaren forderte Schieffer stets den Rückgriff auf eine gesicherte Quellenbasis. Das zeigt sich auch in den Themen, mit denen er seine Schüler betraute: Unter den 29 von ihm betreuten Dissertationen befinden sich nicht weniger als elf Editionen, die in den Reihen der MGH veröffentlicht wurden.
Schieffers analytischer Verstand und seine schnelle Auffassungsgabe versetzten ihn in die Lage, Dinge auf das Wesentliche zu reduzieren und klar zu benennen, und machten ihn empfindlich gegen weitschweifige Unverbindlichkeit. Auf sein Urteil war Verlass, und zahlreiche Manuskripte verdanken seinem kritischen Blick entscheidende Verbesserungen, ohne dass er davon viel Aufhebens gemacht hätte, wie er überhaupt seine Person nie in den Vordergrund stellte. Eine Festschrift hat er sich zum Beispiel kategorisch verbeten, Ehrungen, Preisverleihungen und Kooptationen in nationale und internationale Wissenschaftsorganisationen verheimlichte er selbst gegenüber Kollegen. Dabei war seine Mitgliedschaft im Wissenschaftsrat (1984-1990) eine außergewöhnliche Anerkennung. Dass Schieffer schließlich 1990/91 auch jener Evaluations-Kommission angehörte, die nach der Wende Arbeit und Personen der Akademie der ehemaligen DDR zu beurteilen hatte, hat ihn eher belastet, und zutiefst unglücklich war er darüber, dass es nicht gelungen war, die Abwicklung des Göttinger Max-Planck-Instituts für Geschichte zu verhindern (2006).
Manche der neuen Verpflichtungen waren dem Umstand geschuldet, dass Schieffer 1992 als Nachfolger Horst Fuhrmanns zum Präsidenten der MGH gewählt und somit gleichsam zum Repräsentanten der deutschen Mediävistik wurde, gerade auch gegenüber dem Ausland. Nach Überwindung einer lebensbedrohlichen Erkrankung konnte er das Amt schließlich 1994 antreten. Es gelang ihm, das Institut personell und finanziell auszubauen. Unter seiner Präsidentschaft erlebten die MGH den relativ größten ‚Output‘ an vorbildlichen Editionen, auch des Präsidenten selbst, die das internationale Renommee des Münchner Instituts festigten. Beeindruckend war, wie Schieffer jederzeit die spezifischen Probleme der laufenden Editionsprojekte entfalten und beurteilen konnte. Der Digitalisierung öffnete er sich persönlich nur zögerlich, sorgte aber erstmals für eine EDV-Stelle, so dass das Institut bis zum Ende seiner Amtszeit nicht nur auf dem Feld der Retrodigitalisierung Standards setzte, sondern sich auch die Tür zu digitalen Editionen öffnete.
Mit seiner Wahl zum Präsidenten der MGH war die Berufung an die Münchner Universität verbunden, wenn auch mit deutlich reduziertem Lehrdeputat. Das schränkte den engeren Schülerkreis zwar ein, schmälerte aber seine Anziehungskraft keineswegs: Sein letzter Doktorand war ein japanischer Stipendiat. Der Abschied vom Präsidentenamt der MGH verlief nach 18 Jahren (2012) für Schieffer enttäuschend, weil die zugespitzte Kontroverse mit dem zuständigen bayerischen Staatsministerium um die Zukunft der MGH in eine Richtung wies, die er als Bedrohung der Selbständigkeit ‚seines‘ Hauses empfand. Die Mitgliedschaft in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften hatte er nach internen Streitigkeiten bereits 2007 aufgegeben. Unmittelbar nach seinem Ausscheiden aus dem Amt verlegte er seinen Wohnsitz wieder nach Bonn, wo er wohl seine glücklichste und erfolgreichste Zeit als Hochschullehrer verbracht hatte.
Einen ersten Faszikel der Hinkmarbriefe, mit deren Edition er seinerzeit beauftragt worden war, hat er in Bonn noch fertigstellen können, nachdem er bereits 2003 „Die Streitschriften Hinkmars von Reims und Hinkmars von Laon“ veröffentlicht hatte. Die Auslieferung des Bandes hat Schieffer nicht mehr erlebt. Die Hoffnung, dass er die tückische Krankheit, die ihn befallen hatte, ebenso werde besiegen können wie jene, die fast seine Berufung als Präsident der MGH verhindert hatte, erfüllte sich nicht.
Rudolf Schieffer war unbestritten einer der Großen des Fachs. Sein umfangreiches und thematisch sowie chronologisch staunenswert breites Œuvre hat in seiner Generation nicht seinesgleichen. Schwerpunkte seiner Publikationen sind die Karolinger- und Ottonenzeit, der sogenannte „Investiturstreit“, die Reichskirche und das Papsttum, einschließlich des frühmittelalterlichen Kirchenrechts. Immer wieder kam er auf Karl den Großen zu sprechen, sodann auf Papst Gregor VII., dem er auch eine Monographie widmete und an dessen Beispiel er schon sehr früh das Problem historischer Größe erörterte. Kennzeichnend für alle Arbeiten ist der stete Rekurs auf die Quellen und der Fokus auf die politische, Kirchen-, Rechts- und Geistesgeschichte, die er nach Möglichkeit in europäischer Perspektive beschrieb, während Schieffers wirtschafts- und sozial- oder kulturgeschichtliches Interesse eher randständig war und er gegenüber manchen Facetten „moderner Mediävistik“ reserviert blieb.
Immer wieder behandelte er landesgeschichtliche Themen, auch über seine rheinischen und bayerischen Wirkungsfelder hinaus, sowie die Geschichte des eigenen Fachs und der MGH oder das Wirken einzelner Fachvertreter. Daneben beleuchtete er zum Beispiel die „historische Dimension der europäischen Einigungsdebatte“ in einem Beitrag, den der Deutsche Hochschulverband 2006 unter die „Glanzlichter der Wissenschaft“ reihte.
Schieffer war zugleich ein sehr erfolgreicher Lehrer, aus dessen Schülerkreis vier ebenfalls eine Professur erreichten. Martina Hartmann (geboren 1960) folgte 2018 im Präsidentenamt der MGH. Durch eine rege Vortragstätigkeit vermittelte Schieffer die Ergebnisse mediävistischer Forschung in prägnanter Form einer breiteren Öffentlichkeit, und auch als Experte in TV-Dokumentationen oder zur Vorbereitung großer Ausstellungen wurde er häufig um Rat gebeten. Seine gefragten Gutachten wirkten nachhaltig im Fach und dessen Institutionen.
Persönlich war Schieffer eher zurückhaltend und wahrte trotz seines freundlichen Wesens Distanz, auch zu engsten Mitarbeitern und Fachkollegen. Dabei verfügte er durchaus über Witz und eine feine, nie verletzende Ironie. Das Rheinland, die rheinische Lebensart und seine Konfession waren ihm Heimat, auch wenn Schieffer seinem Naturell nach kein typischer Rheinländer war. Er starb am 14.9.2018 in Bonn und wurde in der Familiengrabstätte auf dem Burgfriedhof in Bad Godesberg bestattet.
Nachlass
Der private Nachlass befindet sich im Archiv der MGH (München), die Privat-Bibliothek im Historischen Seminar der Universität Wuppertal.
Personalakten in den Universitätsarchiven Bonn (PF-PA 1065, PA 12353) und der LMU München (FakGuK-X-002 bzw. IX-148).
Schriften (Auswahl)
Editionen
Acta Conciliorum Oecumenicorum IV/3: Index generalis tomorum I-IIII, 3 Bände, Berlin 1974-1984.
Hinkmar von Reims, De ordine palatii (MGH Font. iur. Germ. ant. 3) (zus. mit Thomas Gross), Hannover 1980.
Die Streitschriften Hinkmars von Reims und Hinkmars von Laon 869-871 (MGH Conc. 4, Suppl. II), Hannover 2003.
Die Briefe des Erzbischofs Hinkmar von Reims (MGH Epp. 8/2) (nach Vorarbeiten von Ernst Perels und Nelly Ertl), Wiesbaden 2018.
Monographien, selbständige Publikationen
Die Entstehung von Domkapiteln in Deutschland, Bonn 1976, 2. Auflage 1982.
Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den deutschen König, Stuttgart 1981.
Die Karolinger, Stuttgart 1992, 5. Auflage 2014.
Der geschichtliche Ort der ottonisch-salischen Reichskirchenpolitik, Opladen 1998.
Albertus Magnus. Mendikantentum und Theologie im Wettstreit mit dem Bischofsamt, Münster 1999.
Das Grab des Bischofs in der Kathedrale, München 2001.
Neues von der Kaiserkrönung Karls des Großen, München 2004.
Die Zeit des karolingischen Großreichs 714-887 (Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, 10. Auflage, Band 2), Stuttgart 2005.
Papst Gregor VII. Kirchenreform und Investiturstreit, München 2010.
Wissenschaftliche Arbeit im 9. Jahrhundert, Paderborn 2010.
Christianisierung und Reichsbildungen. Europa 700-1200, München 2013.
Die ältesten Judengemeinden in Deutschland, Paderborn 2015.
Bibliographie
Rudolf Schieffer 1947-2018, hg. von den MGH, München 2019, S. 45-75, bearb. von Claudia Zey.
Literatur
Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1990, S. 145-146.
Laudatio von Erich Meuthen, in: NRW Akademie der Wissenschaften, Jahrbuch 1992, S. 98-101.
Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1997, S. 141-142.
Der Konstanzer Arbeitskreis 1951-2001, bearb. von Jörg Schwarz, hg. von Jürgen Petersohn, Stuttgart 2001, S. 341-347.
Kürschners Deutscher Gelehrtenkalender, 26. Ausgabe, Band 3, Berlin 2014, S. 3175.
Hartmann, Martina, Rudolf Schieffer und die Monumenta Germaniae Historica, in: Rudolf Schieffer 1947-2018, S. 9-25.
Märtl, Claudia, Rudolf Schieffer als Wissenschaftler, in: Rudolf Schieffer 1947-2018, S. 27-44.
Nachrufe
Becher, Matthias, in: Jahrbuch der NRW Akademie der Wissenschaften und Künste 2019, S. 127-131.
Bünz, Enno, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 81 (2018), S. 793-795.
Bünz, Enno, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 75 (2019), S. 177-180.
Esch, Arnold, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 99 (2019), S. 535-536.
Herbers, Klaus, in: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 114 (2019), S. 1-4.
Körntgen, Ludger, in: Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 139 (2019), S. 625-632.
Ostrowitzki, Anja [Online]
Riedmann, Josef, in: Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Jg. 168 (2018), Wien 2019, S. 400-402.
Zey, Claudia, in: Historische Zeitschrift 310 (2019), S. 90-100.

Rudolf Schieffer und die heutige MGH-Präsidentin Martina Hartmann auf einer Studienfahrt in Rom, 1984. (Privatbesitz Letha Böhringer)
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.
Kölzer, Theo, Rudolf Schieffer, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/rudolf-schieffer/DE-2086/lido/65b0e00f933516.32958338 (abgerufen am 30.04.2024)