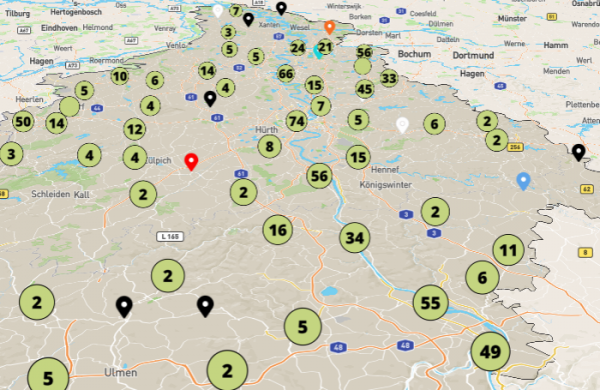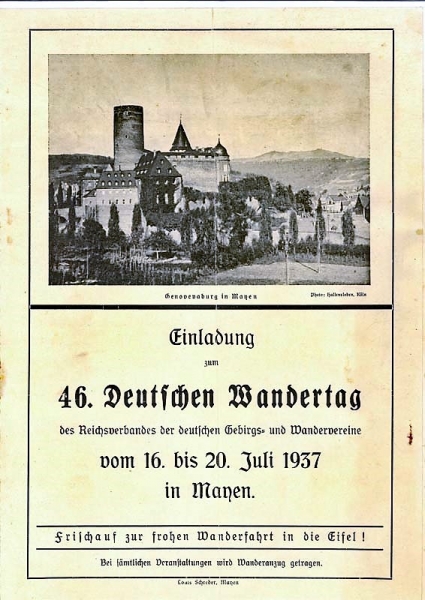Zu den Kapiteln
1. Einleitung und Fragestellung
Am Morgen des 7.3.1936 marschierten deutsche Streitkräfte in die entmilitarisierte Zone im Rheinland ein.[1] Dies stellte eine grobe internationale Rechtsverletzung dar, denn Deutschland durfte nach den geltenden Verträgen dort keine militärische Präsenz haben. Die Wehrmachtssoldaten, insgesamt 19 Bataillone Infanterie und 13 Artillerieabteilungen, unterstützt von 30.000 Mann Landespolizei, stießen in mehreren Kolonnen zum Rhein vor. Vormittags kreisten mehrere Flugzeuge der deutschen Luftwaffe über Köln, drehten aber wieder ab, weil keine geeigneten Landemöglichkeiten bestanden. Gegen Mittag trafen die Streitkräfte in Duisburg, Düsseldorf und Mainz ein. Gerade in dem Moment, als der deutsche Reichskanzler Adolf Hitler (1889-1945) in Berlin vor dem Reichstag die Annullierung des Locarnopaktes und das Ende der entmilitarisierten Zone verkündete, überquerten die deutschen Truppen mit Servicewägen und Kavallerie den Rhein auf der Hohenzollernbrücke in Köln und zogen am Bahnhof vorbei bis zur Hauptpost, wo sie vom Kölner Oberbürgermeister empfangen wurden. Lediglich drei Bataillone, insgesamt knapp 3.000 Mann, rückten vom Rhein weiter westwärts vor und erreichten am Nachmittag die Städte Aachen, Trier und Saarbrücken. Am Abend kam es im gesamten Rheinland sowie überall im Reich zu spontanen Jubelfeiern und Kundgebungen.
Eine Zeitzeugin schrieb: Ich war ganz überwältigt von dem Geschehen dieser Stunde, erdrückt von Problemen, beglückt vom Einmarsch unserer Soldaten, von der Größe Hitlers und der Macht seiner Sprache, der Gewalt dieses Mannes [...] Wir haben diese Sprache ersehnt, diese Festigkeit, als die Zersetzung bei uns regierte mit der Entente zusammen. Aber an solche Taten hätten wir nicht zu denken gewagt. Immer wieder stellt der Führer die ganze Welt vor eine vollendete Tatsache. Wenn die Welt seit 2000 Jahren solche Sprache gehört hätte – hätten wir nur sehr selten so zu sprechen brauchen, wären immer verstanden worden und hätten uns viel Blut, Tränen, Landverlust und Erniedrigung ersparen können. Stimmungsberichte wurden aus allen Städten gegeben, ein Jubel ohnegleichen.[2]
Und die Presse jubelte: Der 7. März 1936 ist über Nacht zu einem der großen geschichtlichen Tage des neuen Deutschland geworden. Als dieser Tag heraufbrach, wusste in den westlichen Provinzen unseres Vaterlands noch niemand, dass in den Mittagstunden der in der ganzen Bevölkerung so heiß ersehnte Augenblick kommen würde: der Einzug der deutschen Truppen in ihre Friedensgarnisonen am Rhein. Fast achtzehn Jahre lang haben wir im Westen des Reichs im Ausnahmezustand gelebt. Länger als anderthalb Jahrzehnte zwang der Wille der Diktatoren von Versailles das Deutsche Reich in die demütigende Souveränitätsbeschränkung – demütigend weil sie einseitig war, und weil der deutschen neutralen Zone gegenüber gewaltige Befestigungen der französischen Armee entstanden als ausgesprochener Faktor der Unsicherheit in Westeuropa.[3]
Und weiter: Der historische 7. März erlebte einen denkwürdig-feierlichen Abschluss. Wie in zahlreichen anderen Orten des Rheinlands und wie in Berlin vor dem Führer, so hatten sich in der rheinischen Metropole [Köln] spontan die Kolonnen der Bewegung gesammelt, um in einer großen Freiheitskundgebung dem Führer Dank zu sagen. Kaum hatte der Reichssender Köln bekannt gegeben, dass der Abend mit einem Fackelzug beschlossen würde, als Tausende und Abertausende zu den Aufmarschplätzen strömten. Nach 21 Uhr setzte sich der mehrere tausend Mann zählende Zug am Heumarkt in Marsch. Und wieder umsäumten Zehntausende alle Straßen, der der Zug berührte.[4]
Schon die Zeitgenossen spürten, dass die Remilitarisierung des Rheinlands ein epochales Ereignis war. Die historische Forschung hat dies immer wieder aufs Neue bestätigt. Die Wiederbesetzung der entmilitarisierten Zone am Rhein und die durch sie ausgelöste Rheinlandkrise waren aus verschiedenen Gründen eine wichtige Wegscheide in der Zwischenkriegszeit. Dies hatte mehrere Gründe:
- Rhein und Ruhr galten in der Zwischenkriegszeit als zentrale Objekte der internationalen Politik. Nahezu alle Problemlinien, die sich aus der im Versailler Vertrag geschaffenen Nachkriegsordnung ergaben, waren hier wie in einem Brennglas gebündelt und bestimmten damit die zwischenstaatlichen Beziehungen der Großmächte Frankreich, Großbritannien und Deutschland.[5]
- Die Remilitarisierung des Rheinlands war eine entscheidende Marke auf Hitlers Weg in den Krieg. Der deutsche Reichskanzler bezeichnete diesen Schritt später immer wieder als äußerst wagemutige Unternehmung. Die 48 Stunden nach dem Einmarsch, so ließ er sich vernehmen, seien die aufregendsten Stunden in seinem Leben gewesen. So war es kein Wunder, dass Hitler nach der überstandenen Feuerprobe jede Zurückhaltung ablegte und fortan keine Grenzen mehr kannte. Ganz umnebelt vom Glauben an die eigene Unfehlbarkeit formulierte Hitler nach der Rheinlandkrise sein neues Bewegungsgesetz: Weder Drohungen noch Warnungen werden mich vom meinem Weg abbringen. Ich gehe mit traumwandlerischer Sicherheit den Weg, den mich die Vorsehung gehen heißt.[6]
- Schließlich kam der Rheinlandkrise die entscheidende wegweisende Bedeutung zu, weil in diesem Augenblick die letzte Chance vertan wurde, Hitler ohne einen großen Krieg zu stoppen. Ein letztes Mal, so schien es den Zeitgenossen, hätten England und Frankreich die Möglichkeit gehabt, Hitlers Vertragsbruch mit einer einfachen Polizeiaktion zu bestrafen. Sogar Hitler selbst soll gesagt haben, wenn die Franzosen während der Rheinlandaktion ins Rheinland eingerückt wären, hätte sich Deutschland mit Schimpf und Schande zurückziehen müssen.[7] Doch mit der Entscheidung, Hitlers „Fait accompli“ nicht mit einer militärischen Aktion zu beantworten, war diese Gelegenheit ein für alle Mal verspielt. Fortan war das Deutsche Reich an seiner westlichen Grenze so gesichert, das militärische Potenzial des Landes so gewaltig, dass der Vernichtungswille Hitlers nur noch durch einen weltumspannenden Krieg aufgehalten werden konnte.
Diesem wichtigen und bedeutsamen Ereignis nähert sich dieser Beitrag auf drei Ebenen an: Zunächst sollen die vertragliche Grundlegung und der völkerrechtliche Status der entmilitarisierten Zone während der Zwischenkriegszeit beschrieben werden. Dann sollen die Auswirkungen der Entmilitarisierung auf die Situation im Rheinland skizziert werden. Schließlich soll der Verlauf der Remilitarisierung selbst dargestellt werden. Im Mittelpunkt stehen die Entscheidung, der Ablauf der Aktion sowie die Frage, wie die anderen Mächte (England und Frankreich) auf den Handstreich Hitlers reagierten.
2. Die völkerrechtlichen Bestimmungen zur entmilitarisierten Zone am Rhein (1918-1933)
Um dem französischen Sicherheitsbedürfnis nach dem Ersten Weltkrieg Rechnung zu tragen, bestimmte der Versailler Vertrag (VV) vom 28.6.1919, dass das gesamte linksrheinische Gebiet Deutschlands sowie ein Streifen rechts des Rheins, dessen Begrenzung stets in einem Abstand von 50 Kilometern entlang des Flusses verlaufen sollte, auf Dauer entmilitarisiert werden sollte.[8] Das bedeutete, dass innerhalb dieser Zone das Deutsche Reich keine militärischen Befestigungsanlagen unterhalten durfte (Artikel 42 VV) und dass dort jegliche Truppenansammlungen untersagt waren (Artikel 43 VV). Zur besonderen Bekräftigung dieser Bestimmungen wurde festgelegt, dass jeder Verstoß gegen die Artikel 42 und 43 VV als Verstoß gegen den Weltfrieden gewertet und eine unmittelbare Aktion aller Völkerbundmächte nach sich ziehen würde (Artikel 44 VV).[9] Diese Bestimmungen bildeten in den folgenden Jahren immer wieder den Anlass für diplomatische Auseinandersetzungen, wurden aber kaum substanziell verändert. Zwar versuchten die Franzosen immer wieder, aus der entmilitarisierten Zone eine neutralisierte Zone zu machen und diese dann mit Kontrollposten zu überwachen, doch in Deutschland lehnte man solche Vorhaben rundweg ab, weil man fürchtete, die Neutralisierung könnte die staatsrechtliche Stellung des Rheinlands tangieren.
Dagegen trat Gustav Stresemann (1878-1929) mit der Idee eines deutsch-französischen Sicherheitsvertrags hervor. Dieser Vorschlag mündete im Herbst 1925 in der Unterzeichnung des Locarnovertrags, einem wichtigen Meilenstein der internationalen Entspannung. Im sogenannten Rheinpakt, dem Kern des Locarnovertrags, wurde die Existenz der entmilitarisierten Zone noch einmal bekräftigt, jedoch mit einigen Veränderungen im Vergleich zum Versailler Vertrag. So gab die sogenannte „Provokationsklausel“ des Artikels 4 des Rheinpaktes den Franzosen nur im Falle eines „flagranten Verstoßes“ das Recht zum unmittelbaren Handeln, wie es der Artikel 44 des Versailler Vertrages vorsah; über alle anderen Verstöße hatte der Völkerbundsrat in Genf zu entscheiden.[10]
In Paris störte man sich daran, dass der Rheinpakt von Locarno die Entmilitarisierung des Rheinlands festschrieb, ohne zu sagen, wie dieser Zustand in der Praxis kontrolliert werden sollte. Das wurde nach der Unterzeichnung in Frankreich als „Lücke“ des Vertrages empfunden. Fieberhaft arbeiteten die französischen Diplomaten daran, diese zu schließen. Die französischen Vorstellungen kreisten um den Gedanken, feste Überwachungsorgane in der Rheinlandzone, sogenannte éléments stables zu errichten, die den entmilitarisierten Status des Rheinlands sichern sollten.[11] Die Franzosen richteten ihre Hoffnungen zunächst auf den Völkerbund, doch das dort verabschiedete Investigationsprotokoll vom November 1926 scheiterte. Demnach sollten Investigationen in Deutschland zur Überprüfung der Entwaffnungsmaßnahmen nur mit Zustimmung der deutschen Regierung zulässig sein; ständige Kontrolleinrichtungen für die entmilitarisierte Zone waren gar nicht vorgesehen. Im Herbst 1928 richtete Paris sein Augenmerk erneut auf das Regelwerk von Locarno. Anknüpfend an Artikel 4 des Rheinpaktes, wonach jeder Verstoß gegen die entmilitarisierte Zone vor den Völkerbundsrat zu bringen sei, entwickelten die französischen Juristen ein mehrstufiges Verfahren zur Feststellung solcher Vergehen. So sollten nur die als flagrant bezeichneten sowie die normalen Verstöße gegen die entmilitarisierte Zone vor den Rat des Völkerbundes kommen, während alle kleineren Verletzungen vor eine gemischte Kommission zu tragen seien, die eigens für solche Fälle gebildet werden sollte. Diese Commission de conciliation et constatation, wie sie der französische Außenminister Aristide Briand (1862-1932) nannte, könne einfacher und schneller arbeiten als der Völkerbund.[12] Die Deutschen lehnten diese Idee ab.
Letztlich konnte die deutsche Seite bis zum Ende der 1920er Jahre alle Versuche Frankreichs abwehren, die auf eine Verschärfung der Entmilitarisierungsbestimmungen hinausliefen; umgekehrt blieb der Status der entmilitarisierten Zone aber auch über das Ende der Rheinlandbesetzung im Sommer 1930 hinaus bestehen und bildete damit eine ständige Quelle für internationale Streitigkeiten. Das sollte sich mit der Regierungsübernahme Hitlers alsbald erweisen.
3. Hilfspolizei in der entmilitarisierten Zone (1933)
Dass die Nationalsozialisten bei ihrer Machtübernahme mit der entmilitarisierten Zone am Rhein gleichsam den empfindlichsten Punkt innerhalb des Abrüstungsproblems geerbt hatten, wurde bereits im Frühjahr 1933 deutlich. Es betraf eine Besonderheit der NS-Machtergreifung, und zwar die Aufstellung von sogenannter Hilfspolizei.[13] Am 22.2.1933 bestimmte der preußische Reichskommissar Hermann Göring (1893-1946), in Preußen eine Hilfspolizei aufzustellen, die sich aus Mitgliedern der nationalsozialistischen Wehrverbände rekrutierte. Gemäß der so genannten „Kuppelungstaktik“ war den regulären Polizeiposten je ein Mann aus der SA/SS-Hilfspolizei beizugeben. Die so in Preußen und in anderen Ländern aufgestellte Hilfspolizei hatte den Auftrag, politische Gegner rücksichtslos zu verfolgen und einzusperren, womit sie sich zu einem wichtigen Instrument der „braunen Revolution“ entwickelte. Problematisch war die Aufstellung der Hilfspolizei in der entmilitarisierten Zone am Rhein, denn die Zahlenstärken, über welche die deutsche Polizei dort verfügen durfte, waren durch eine Reihe internationaler Abmachungen geregelt. Im Juni 1920 gestatteten die Alliierten in der sogenannten Polizeinote von Boulogne dem Deutschen Reich Polizeikräfte im Umfang von 150.000 Mann zu, die das Innenministerium frei über das Reichsgebiet verteilen konnte; man rechnete mit einem Bedarf von 14.000 Mann Polizei, um die Ordnung in der entmilitarisierten Zone aufrechterhalten zu können. Später wurde dem Deutschen Reich ausdrücklich verboten, die reguläre Polizei durch freiwillige Hilfspolizei zu verstärken. In einem Notenwechsel vom 10.1.1930 klärten das Reich und die alliierten Mächte die Frage, wie viel Polizei das Reich in der entmilitarisierten Zone unterhalten durfte. Darin setzte sich Deutschland mit der Ansicht durch, Polizeieinheiten nicht zu den „bewaffneten Streitkräften“ im Sinne des Artikels 43 des Versailler Vertrages zu rechnen; dennoch wurde die Höchstgrenze für Polizei in der entmilitarisierten Zone auf 30.000 Mann festgesetzt und Deutschland musste sich verpflichten, Verstärkungen den „interessierten Regierungen“ mitzuteilen.
Im Frühjahr 1933 protestierten die britische und die französische Regierung scharf gegen die Aufstellung der Hilfspolizei in der entmilitarisierten Zone[14], so dass sich die deutsche Regierung veranlasst sah, der Hilfspolizei ein Ende zu machen. Am 11.5.1933 fand im Reichsinnenministerium eine Konferenz statt, auf der über die Zukunft der Hilfspolizei beraten wurde. Dort sagte das Reich zu, sich bis zum 14.5.1933 an der Finanzierung der Hilfspolizei zu beteiligen. Danach müsse sich die Hilfspolizei auflösen_. Außenpolitische wie finanzielle Gründe_, so führte der Staatssekretär im Reichsinnenministerium aus, fordern einen tunlichst baldigen Abbau der Hilfspolizei. Am folgenden Tag wurden die Ministerien der Länder über den Beschluss verständigt, die Auflösung der Hilfspolizei erfolgte in allen Ländern im Laufe des Sommers 1933.[15]
4. Aufbau eines Grenzschutzes im Westen (1933-1936)
Doch mit der Auflösung der Hilfspolizei war das Problem nicht aus der Welt. Noch immer trieben paramilitärische Verbände, wie SA, SS und Stahlhelm, in der entmilitarisierten Zone ihr Unwesen. Dies geschah unter dem Deckmantel des von der Reichswehr eingerichteten Grenzschutzes, der seit dem Frühjahr 1933 völlig neu aufgestellt wurde.[16] Als Erstes richtete man unter dem Dach des Finanzministeriums einen „verstärkten Grenzschutz“ ein, indem zusätzliches Personal auf die einzelnen Zollabschnitte verteilt wurde; insgesamt waren 2.000 Mann, die sich hauptsächlich aus den Wehrverbänden rekrutierten, im Zolldienst beschäftigt. Als Nächstes bemühten sich die Militärs, die SA in den Grenz- und Landesschutz einzubinden. Dazu war beabsichtigt, die SA zunächst für die vormilitärische Ausbildung zu nutzen. Ab April 1933 begann die SA, kleine Kontingente zur Ausbildung an die Reichswehr abzustellen. Das Ziel war, 250.000 SA-Männer so auszubilden, dass sie im Kriegsfall der Reichswehr zugeführt werden könnten. Außerdem war geplant, die SA im Grenzschutz einzusetzen, und zwar schwerpunktmäßig im Westen, wo der Einsatz der Reichswehr auf Grund der entmilitarisierten Zone untersagt war. Die Rheinlandzone war in verschiedene Abschnitte zu unterteilen, in denen im Kriegsfall die Polizei in Absprache mit den Befehlshabern der Wehrkreise die Zerstörung der Rheinübergänge organisieren sollte.[17]
Nach dem Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund im Oktober 1933 intensivierte die Reichswehr ihre Pläne zu einer umfassenden Landesverteidigung. Die operative Planung wurde an die Gegebenheiten eines „Sanktionskrieges“ angepasst, in welchem Frankreich und seine Verbündeten Deutschland in einen Zweifrontenkrieg verwickeln würden. Im Falle von Sanktionsmaßnahmen, so lautete die Weisung des Reichswehrministers Werner von Blomberg (1878-1946) an die Reichswehr vom 25.10.1933, sollte die Reichswehr unabhängig von den Erfolgsaussichten Widerstand leisten. Operatives Ziel des Heeres im Westen sollte es sein, mit Unterstützung der Landespolizei die Rhein-Roer-Schwarzwald-Linie zu halten. Ein französischer Angriff sollte auf drei Stufen pariert werden: Auf der ersten Stufe sollte unter Führung der SA die Räumung des linksrheinischen Gebiets organisiert werden, um daraufhin auf der zweiten Stufe einen „Sicherungsschleier“ am Rhein aufzubauen. Auf der dritten Stufe sollte die Reichswehr im Harzer Raum die französischen Kolonnen in der Flanke angreifen. Gleichzeitig begann das Luftfahrtministerium, an Rollfeldern in der Zone zu arbeiten.[18]
Aber dieses Konzept des Grenzschutzes barg auch Risiken. In der entmilitarisierten Zone mussten alle militärischen Vorbereitungen unterlassen werden, wenn man Frankreich nicht zum Krieg anstacheln wollte. Daher waren die verschiedenen militärischen Maßnahmen in der Rheinlandzone zu tarnen. Der Erlass der Heeresleitung vom 3.11.1933 zum Aufbau der „Grenzsicherung West“ trug diesen Überlegungen Rechnung. So enthielt der Erlass zahlreiche Bestimmungen zur organisatorischen Einteilung der Zone sowie zum Orts- und Polizeischutz. Sein Kernstück aber, der „Verstärkte Grenzaufsichtsdienst“ (VGAD), wurde einstweilen zurückgestellt. Dazu kam die ausdrückliche Warnung, alle Maßnahmen in der entmilitarisierten Zone geheim zu halten sowie den Schriftverkehr mit Dienststellen außerhalb der Reichswehr zu beschränken.
Auch im Jahr 1934 wurde der Ausbau des Grenzschutzes von den Bestimmungen der entmilitarisierten Zone gebremst. Zwar hatten sich Auswärtiges Amt und Reichswehrministerium im Sommer 1934 auf gemeinsame Richtlinien geeinigt, wie Militärfeiern und Aufmärsche von Wehrverbänden in der entmilitarisierten Zone zu handhaben seien, aber schon im September 1934 unternahmen Göring und der Oberpräsident der Rheinprovinz, Hermann von Lüninck, einen Vorstoß, gewisse Bestimmungen in der Rheinzone wieder zu lockern. Aufmärsche von SA und SS sollten in Zukunft freigegeben werden. Wieder protestierten Auswärtiges Amt und Reichswehrministerium auf das schärfste. Daraufhin wurden im Oktober neue Bestimmungen für Veranstaltungen in der Zone erlassen. Militärische Festlichkeiten waren danach grundsätzlich untersagt. Feiern kleiner Kriegervereine waren nur erlaubt, wenn sie sich im örtlichen Rahmen hielten. Es sei darauf zu achten, einen „militärischen Charakter“ zu vermeiden, das Tragen von Waffen und Stahlhelm war verboten. Lediglich sportliche Veranstaltungen der SA waren erlaubt.[19]
Den Grenzschutz übernahmen in der entmilitarisierten Zone Wehrverbände und Einheiten der Polizei; die Reichswehr trat nicht in Erscheinung. Nach der Ausschaltung der SA am 30.6.1934 gingen die Kompetenzen mehr und mehr auf die Landespolizei über. Deren Verbände waren kaserniert und militärisch organisiert. Sie sollte nach dem Willen der Reichswehr den Grenzschutz in den nächsten Jahren „als Überbrückung“ übernehmen.[20] Als am 16.3.1935 dekretiert wurde, die Landespolizei in der Reichswehr aufgehen zu lassen, schien sich die Möglichkeit zu bieten, die Aufgaben der westlichen Landesverteidigung in die Hände der Reichswehr zu legen. Vor diesem Schritt schreckte man aber zurück. Bereits am 19.3.1935 erklärte General Walter von Reichenau (1884-1942), die Landespolizei im Bereich der entmilitarisierten Zone werde im Gegensatz zur restlichen Landespolizei im Reichsgebiet nicht in das Heer übernommen, sondern bleibe in der jetzigen Form bestehen. Am 29. März sanktionierte das Kabinett diese Regelung. Somit blieb auch im Jahr 1935 die Situation im Rheinland unklar. Einerseits trugen die Militärs Sorge dafür, militärische Exzesse im Rheinland zu vermeiden. So wies Ludwig Beck (1880-1944) noch einmal darauf hin, dass alle einschränkenden Bestimmungen (betreffend zum Beispiel Übungen, Geländebesprechungen) in der Rheinlandzone voll erhalten blieben. Andererseits arbeiteten die Militärs weiter daran, die Bestimmungen der Rheinzone zu unterlaufen, indem man neue Grenzschutzbataillone im Schwarzwald aufstellte und hierfür wieder Wehrverbände für den Grenzschutz in Anspruch nahm. Anfang März 1935 einigten sich die Militärs mit SA und SS auf gemeinsame Richtlinien für den Grenzschutz. Weitere Maßnahmen folgten im Sommer. Die Vorbereitungen reichten von Mobilmachungsmaßnahmen für die Landespolizei über die Planungen zur Freimachung des Rheins bis hin zu Vorbereitungen des Ortsschutzes, des VGAD und verschiedener Sperrmaßnahmen. Im November wurde der Landespolizei durch einen Erlass Hitlers gestattet, die graugrüne Uniform anzulegen, was ihren militärischen Charakter noch einmal unterstrich. Des Weiteren begannen die Militärs, die entmilitarisierte Zone in den Bereich des Heeresaufbaus einzubeziehen und Kasernenbauten im Rheinland zu errichten. Im Dezember 1935 referierte General Wilhelm Keitel (1882-1946) auf einer Sitzung des Reichsverteidigungsrates, welche Maßnahmen an den westlichen Grenzen zur Umsetzung kämen. So berichtete er von umfangreichen Maßnahmen der Schutzpolizei, die im Rahmen des Ortsschutzes einen Luftschutzordnungsdienst und einen „Verstärkten Polizeischutz“ organisierte. Dazu habe die Reichswehr angeordnet, im Saargebiet einen VGAD einzurichten.[21]
5. Die geheime Aufrüstung in der entmilitarisierten Zone (1933-1936)
Doch nicht nur für die Planungen zur Reichsverteidigung entpuppte sich die Existenz der entmilitarisierten Zone immer wieder als Hindernis. Auch die hochfliegenden Pläne der deutschen Spitzenmilitärs, das Deutsche Reich innerhalb weniger Jahre zu einer hochgerüsteten Militärmacht zu machen, stießen im Rheinland immer wieder an ihre Grenzen. Denn hier waren die meisten Maßnahmen untersagt. Dies betraf in den Jahren 1934/35 etwa die Anlegung von Flugplätzen in der entmilitarisierten Zone oder die Durchführung der Wehrpflicht nach deren Wiedereinführung am 16.3.1935. Die Anlegung von geheimen Flugplätzen im Rheinland durch die Deutschen kam zum ersten Mal mit der sogenannten Barthou-Note vom 17.4.1934 an das Licht der Öffentlichkeit.[22] Diese enthielt den Vorwurf, dass Deutschland heimlich Flugplätze in der entmilitarisierten Zone anlege. Mit der Offenlegung dieser Geheimrüstungen war der Versuch des Reichswehrministeriums, auf eigene Faust für die Tarnung und Geheimhaltung aller Rüstungsmaßnahmen in der Zone zu sorgen, schon im Ansatz gescheitert. Wütend wandte sich das Auswärtige Amt am 19.4.1934 an alle Wehrministerien und bat um Stellungnahme, was an den Vorwürfen über Flugplätze in der entmilitarisierten Zone sei. Erste Nachfragen im Reichsluftfahrtministerium ergaben, dass man sich bei der Anlegung von Flugfeldern streng an die Auflagen gehalten habe. Gemäß den Bestimmungen des Luftabkommens vom Mai 1926 habe Deutschland das Recht, in der entmilitarisierten Zone vier Flughäfen (Essen, Köln, Frankfurt/Main und Mannheim) sowie 16 Verkehrslandeplätze anzulegen. Davon seien aber lediglich zehn Rollfelder angelegt. Dagegen gebe es nur eine kleinere Anzahl „wilder Flugplätze“ in Baden (zum Beispiel Offenburg, Kehl).[23] Anfang Mai 1934 stellte sich heraus, dass es weit mehr wilde Flugplätze gab als bislang bekannt. Anscheinend hatte Gauleiter Robert Wagner (1895-1946) die Gemeinden in Baden dazu ermuntert, auf eigene Faust Flugplätze zu errichten. Betroffen waren Rastatt, Kehl, Offenburg, Lahr, Trier, Neustadt an der Hardt und Pirmasens. Die Anlage wilder Flugplätze in der Zone, so Reichsaußenminister Konstantin von Neurath (1873-1956), widerspräche den Erfordernissen der Außenpolitik.[24]
Nach einem Treffen zwischen Vertretern des Auswärtigen Amtes mit Joachim von Ribbentrop und Erhard Milch (1892-1972), dem Vertreter des Reichsluftfahrtministeriums, wurde beschlossen, die Arbeiten an den Flugplätzen in Rastatt, Kehl, Trier, Lachen-Speyerdorf und Pirmasens unverzüglich einzustellen und teilweise rückgängig zu machen. Ein weiterer Problemkreis in der entmilitarisierten Zone nach dem 16.3.1935 war die Frage, ob die allgemeine Wehrpflicht in der Rheinlandzone gelten solle.[25] Dies war von großer politischer Tragweite, denn die ehrgeizigen Heerespläne, die Hitler im März in die Welt posaunte, wurden durch die entmilitarisierte Zone auf zweifache Weise empfindlich gestört. Erstens sah das neue Wehrgesetz vor, ein 36-Divisionen-Heer mit einem Umfang von 500.000 Mann aufzustellen. Diese Stärke war nur zu erreichen, wenn das Reichswehrministerium zur Deckung des Personalbedarfs in der Lage war, auf die Bevölkerung des Rheinlands zurückzugreifen. Zweitens war vorgesehen, die 36 Divisionen auf zwölf Wehrkreise zu verteilen. Wenn man davon ausging, dass in der Rheinlandzone keine Heeresverbände aufgebaut werden durften, drohte ein einfaches Platzproblem die Gesamtplanung zu Fall zu bringen. Bei den Vorarbeiten zur Wehrpflicht seit Herbst 1934 hatten sich die Militärs bemüht, die Bestimmungen der entmilitarisierten Zone zu beachten. So wurden in der Rheinlandzone zunächst keine Bezirkskommandos und lediglich drei Ersatzinspektionen errichtet. Noch im März 1935 stellte das Reichswehrministerium in zwei streng geheimen Direktiven fest, dass das Verbot militärischer Vorbereitungen in der entmilitarisierten Zone auch die Wehrpflicht gemäß Artikel 173 VV umfasse. Jetzt freilich forderte Generalstabschef Ludwig Beck in einem Schreiben an die Heeresleitung vom 2.4.1935, die Ersatzorganisationen in die entmilitarisierte Zone vorzuschieben. Dies sei militärisch notwendig, so Beck, er glaube, dass die Einführung der Wehrpflicht keinen Verstoß gegen den Teil III des Versailler Vertrages darstelle, in welchem die Entmilitarisierung des Rheinlands geregelt sei. So einfach war die Sache aus Sicht des Auswärtigen Amts jedoch nicht. Es gelte vielmehr, so Staatssekretär Bernhard Wilhelm von Bülow (1885-1936), einen Weg zu finden, in welcher Weise das Ersatzgeschäft technisch durchzuführen sei, ohne die Vorschriften der entmilitarisierten Zone zu verletzen. Er empfahl, das Ersatzgeschäft in der Rheinzone durch zivile Behörden durchführen zu lassen.[26] Der Reichskanzler folgte der Anregung des Außenamtes und entschied, die allgemeine Wehrpflicht in der entmilitarisierten Zone von den Behörden der inneren Verwaltung durchführen zu lassen. Diese Entscheidung beruhte allerdings weniger auf der Durchsetzungskraft der Diplomaten, sondern vielmehr darauf, dass die Militärs kalte Füße bekommen hatten. Eine Aufzeichnung von Carl-Heinrich von Stülpnagel (1886-1945) vom 11.4.1935 über die militärpolitische Lage Deutschlands legte schonungslos offen, wie schlecht es um die Verteidigungsfähigkeit des Landes stand. Auf Grund der entmilitarisierten Zone, schrieb Stülpnagel, könne ein französischer Einmarsch nach Deutschland nicht aufgehalten werden. Daher seien Provokationen im Rheinland unbedingt zu unterlassen. Jeder Anschlag auf die Rheinlandzone führe unweigerlich zum Krieg mit Frankreich und Belgien. Der Chef der Heeresleitung übernahm diese Gedankengänge. Die entmilitarisierte Zone, führte Werner von Fritsch am 24. April aus, sei das heißeste Eisen, an dem nicht gerührt werden darf.[27] Am folgenden Tag unterrichtete das Wehrministerium das Auswärtige Amt von diesem Standpunkt: Die augenblickliche gespannte Lage macht es allen Stellen zur besonderen Pflicht, alles zu vermeiden, was die Gegenseite als einen Verstoß gegen die militärischen Bindungen in der entmilitarisierten Zone auslegen könnte. Der Wert der militärischen Maßnahmen in der entmilitarisierten Zone steht in keinem Verhältnis zu der großen Gefahr, die aus dem Bekanntwerden dieser Dinge dem Reich erwachsen würden.[28] Damit war die Einführung der Wehrpflicht in der entmilitarisierten Zone vom Tisch.
6. Die wirtschaftliche Lage in der entmilitarisierten Zone
Neben den militärischen Einschränkungen in der entmilitarisierten Zone, die unmittelbar aus den Bestimmungen des Versailler Vertrags rührten, verspürten die Zeitgenossen aber noch weitere Auswirkungen des Rheinlandstatuts.[29] Es waren insbesondere wirtschaftliche Nachteile, die das Rheinland zu spüren bekam, so dass das Reichswirtschaftsministerium seit einiger Zeit ein Ende der rheinischen Entmilitarisierung forderte. Seit Langem ging man davon aus, dass das Gebiet der entmilitarisierten Zone wirtschaftlich benachteiligt sei.[30] Dieser Trend verstärkte sich nach 1933 weiter, als die Rüstungsindustrie aus der Rheinlandzone abgezogen und vorrangig in Mitteldeutschland aufgebaut wurde. Das führte seit 1935 zu krisenhaften Entwicklungen. Die Preise auf Lebensmittel stiegen, während die Löhne sanken. Die Absatzzahlen des rheinischen Einzelhandels brachen ein. Aus diesen Gründen hatte sich schon im Herbst 1934 der Reichsstatthalter in Baden, Robert Wagner, an Hitler gewandt, um auf die beunruhigenden Entwicklungen in der badischen Wirtschaft hinzuweisen. Zur gleichen Zeit begann die Reichswehr, die Beschränkungen für rüstungswirtschaftliche Vorarbeiten im westlichen Grenzland, speziell im Ruhrgebiet, zu lockern.[31] Unter Federführung des Reichsinnenministeriums begannen Planungen, Betriebe gezielt im westlichen Grenzland anzusiedeln, um den Abzug der rüstungsrelevanten Industrien nach Mitteldeutschland auszugleichen. Im Juli 1935 trat Wagner mit der Anregung hervor, die entmilitarisierte Zone – als Ersatz für das Militär – verstärkt mit Einheiten von Polizei, Arbeitsdienst und Parteigliederungen zu belegen. Hitler erklärte sich damit sehr einverstanden. Obwohl diese Maßnahmen im Oktober 1935 auf weitere Bereiche ausgedehnt wurden, konnte die Krise nicht überwunden werden.
Deshalb befasste sich der Oberpräsident der Rheinprovinz, Josef Terboven, am 5.2.1936 in einer ausführlichen Denkschrift mit der wirtschaftlichen Lage in der entmilitarisierten Zone. Darin thematisierte er ausführlich die wirtschaftlichen Folgen der Entmilitarisierung auf die rheinländischen Verwaltungsbezirke und machte eine Reihe praktischer Vorschläge, wie der Krise abzuhelfen sei.[32] Daraufhin kam es im Wirtschaftsministerium zur Einrichtung eines Sonderreferats für das linksrheinische Gebiet. Außerdem sollten die Mittel für die „Westhilfe“ aufgestockt werden.[33]
7. Die Stimmung in der rheinischen Bevölkerung (1933-1936)
Unter den militärischen Beschränkungen und den wirtschaftlichen Bedrückungen nahm auch die Stimmung in der rheinländischen Bevölkerung schweren Schaden. Das belegen deutlich die Stimmungsberichte, die das NS-Regime regelmäßig erstellen ließ. Schon im Jahr 1934 klagte der Regierungspräsident von Aachen, dass der gesamte Bezirk in ideeller und wirtschaftlicher Hinsicht unter seiner Zugehörigkeit zur entmilitarisierten Zone leide: So kommen der Bevölkerung erst jetzt in wachsendem Maße die tatsächlichen, im Anfang nicht voll erkannten Auswirkungen des Versailler Vertrags so recht zum Bewusstsein und wirken sich aus in einem sich immer mehr verbreitenden Verlassenschaftsgefühl.[34]
Dies sollte sich nach März 1935 noch weiter steigern, als mit der Verkündung der Wehrhoheit nicht auch gleich die Bestimmungen zur entmilitarisierten Zone fielen, zur Enttäuschung der Bevölkerung: Die Situation werde sich daher nicht bessern, die Industrie im Rheinland bei Rüstungsaufträgen übergangen, Facharbeitern wanderten ab, der Autobahnbau komme nicht voran. Unmittelbar vor der Remilitarisierung des Rheinlands war die Verdrossenheit unter der rheinischen Bevölkerung besonders groß.[35] Die deutschen Regierungen hatten seit langem versucht, durch eine zentral gesteuerte Propaganda im Rheinland den Durchhaltewillen und den Patriotismus der rheinischen Bevölkerung am Leben zu erhalten. So war es auch ab 1933 unter den Nationalsozialisten. Sie verzichteten jedoch darauf, die entmilitarisierte Zone als Revisionsziel zu proklamieren. Im Gegenteil, es war den Nationalsozialisten lange Zeit daran gelegen, die Situation im Rheinland nicht zum Gegenstand einer öffentlichen Debatte werden zu lassen.[36]

Der Reichssender Köln überträgt den Einmarsch der Truppen in Köln am 7. März 1936 auf der Hohenzollernbrücke, Foto: Ludwig Lang. (Rheinisches Bildarchiv/rba_mfL009490_89)
8. Die Remilitarisierung des Rheinlands am 7.3.1936
Anfang 1936 war der Druck, den die Auswirkungen der Entmilitarisierung in wirtschaftlichen und militärischen Belangen auf die deutsche Führung ausübten, ins Unermessliche angestiegen. Allen kleinen Maßnahmen auf dem Gebiet der Wirtschaftshilfe und des Grenzschutzes zum Trotz, blieb mit Blick auf das Rheinland nur das schonungslose Verdikt: Deutsche Sicherheit ist nicht vorhanden, solange weite deutsche Grenzgebiete der Entmilitarisierung unterliegen, während sein Nachbarstaat bis unmittelbar an die Grenze nicht nur ständige Befestigungsanlagen vorschiebt, die mit Geschützen und Maschinengewehren deutsches Land und deutsche Menschen bedrohen, sondern auch seine Truppen dort garnisonieren kann, die in wenigen Stunden in ungeschütztes deutsches Land vorbrechen können.[37]
Vor diesem Hintergrund zeichnete sich deutlich ab, dass die entmilitarisierte Zone im Frühjahr 1936 in den Rang eines unmittelbar zu verwirklichenden Revisionsziels zu schlüpfen schien. Während die deutschen Militärs zur Verwirklichung der deutschen Wehrhoheit schon seit 1933 auf ein Ende der entmilitarisierten Zone hinarbeiteten und Politiker zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Misere den Staat unter Zugzwang setzten, hatte das Auswärtige Amt bislang stets darauf gepocht, die Bestimmungen der entmilitarisierten Zone einzuhalten. Um die Jahreswende 1935/36 trat nun das Auswärtige Amt in das Lager der „Falken“ über; hier hatte man ganz eigene Motive:
- Das Auswärtige Amt war nach einer juristischen Einschätzung zu dem Schluss gekommen, dass der Locarnopakt nach dem Austritts Deutschlands aus dem Völkerbund nicht mehr funktionsfähig war.
- Frankreich und England hätten, weil sie die Lage ebenso einschätzten, bereits damit begonnen, dem Locarnopakt widersprechende Verpflichtungen einzugehen.

Einmarsch deutscher Truppen in Köln am 7. März 1936, Soldaten und Zuschauer vor dem Haupteingang des Hotels Excelsior, Foto: Julius Radermacher. (NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln / Sammlung Ewald (Bp 7357))
- Dies bedeutete, dass über eine Modifizierung Locarnos nicht mehr auf dem Verhandlungsweg entschieden werden konnte, sondern dass die entmilitarisierte Zone als einseitige Belastung nur in einer einseitigen Aktion beendet werden könne. Angesichts einer solch breiten Unterstützerfront entschied Adolf Hitler Anfang Februar 1936, mit dem Locarnopakt zu brechen und die entmilitarisierte Zone am Rhein zu besetzen.[38]
So wurde beschlossen, den Rheinpakt von Locarno zu „kündigen“ mit der Begründung, durch den Abschluss des französisch-sowjetischen Hilfeleistungsvertrags habe der Locarnopakt seinen inneren Sinn verloren und sei damit erloschen.[39] Ein solcher Schritt hätte der Entmilitarisierung am Rhein die „Rechtsgrundlage“ entzogen und Deutschland wäre wieder in der Lage gewesen, militärische Einheiten ins Rheinland zu verlegen. Die Absage an Locarno sollte den Weg für neue Paktkombinationen freimachen. Daher sollte zeitgleich mit der „Kündigung“ Locarnos eine Reihe von Friedensvorschlägen unterbreitet werden (zum Beispiel ein Viererpakt zwischen Deutschland, Frankreich, England und Italien). Auf eine sofortige militärische Besetzung der entmilitarisierten Zone wollte man zunächst aber verzichten. Mochte der Reichskanzler anfangs eine solche Aktion erwogen haben, so wiesen die Diplomaten und die Militärs in allen Gesprächen auf die Gefahren eines solchen Schritts hin. Der Oberbefehlshaber des Heeres erklärte am 12.2.1936, die Wiederbesetzung sei vom Standpunkt der Landesverteidigung aus gesehen eine Notwendigkeit, müsse aber unter allen Umständen ohne Krieg erfolgen. Dasselbe erklärte der Geschäftsträger in Paris, Dirk Forster (1884-1975), als er Mitte Februar zu einer Konferenz mit Hitler gerufen wurde. Keine französische Regierung, so Forster, könne die Remilitarisierung des Rheinlands ohne Widerstand hinnehmen.[40] Das schreckte den Kanzler ab.

Einmarsch deutscher Truppen in Köln am 7. März 1936, Foto: Julius Radermacher. (NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln (Bp 7335))
Den Zeitpunkt für die Aktion wollte sich Hitler noch offenhalten. Hatte er daran gedacht, schon einen positiven Kammerbeschluss zum Anlass für eine Aktion gegen Locarno zu nehmen, machte der Reichsaußenminister demgegenüber geltend, dass die Beschleunigung den Einsatz nicht lohne. Man solle nicht nur den Beschluss des Senats abwarten, um festen Boden unter den Füßen zu haben, sondern auch die Genfer Beratungen zur Abessinienfrage im Auge behalten, die mit einem Zerwürfnis der Locarnogaranten England und Italien enden mussten. Dieser Sicht schloss sich Hitler vorläufig an.[41]

Einmarsch deutscher Truppen in Köln am 7. März 1936, vor dem Hotel Excelsior, Foto: Erich Kämmerer. (NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln / Sammlung Ewald (Bp 7364))
Das Auswärtige Amt begann sogleich mit der diplomatischen Vorbereitung der Aktion. Am 21.2.1936 empfahl ein Beamter der Abteilung IV, der Zeitpunkt sei günstig, das deutsche Memorandum vom 25.5.1935, in dem die Unvereinbarkeit des französisch-sowjetischen Paktes mit dem Rheinpakt von Locarno festgestellt wurde, zu publizieren, um der Weltöffentlichkeit den deutschen Standpunkt vor Augen zu führen. Dies sei ein wichtiger Schachzug, wenn auf die französische Ratifikation von deutscher Seite Schritte bezüglich Locarno, Rheinland, etc. folgen sollten.[42] Noch am selben Tag wurde ein DNB-Kommuniqué veröffentlicht, in dem die deutsche Regierung darauf verwies, dass der französisch-sowjetische Beistandspakt nicht vereinbar mit dem Rheinpakt sei. Gleichzeitig empfahl das Auswärtige Amt Maßnahmen zur Beeinflussung der ausländischen Presse in Fragen der entmilitarisierten Zone. So versandte der Leiter der Politischen Abteilung, Hans-Heinrich Dieckhoff (1884-1952), am 28. Februar ein Rundschreiben, das umfangreiches Material zur Rheinlandzone enthielt. Alle Missionen erhielten ein Exemplar des Buches „Geographic Disarmament“ von John H. Marshall-Cornwall. Darin ging der Autor, ein ehemaliger britischer Militärattaché, auch auf das Problem des Rheinlands ein. Die Einrichtung der entmilitarisierten Zone sei ein einseitiger Akt, bei dem das Prinzip der Gegenseitigkeit außer Acht gelassen worden sei. Die Dauerhaftigkeit der Rheinzone sei nicht vereinbar mit den Friedensbeziehungen souveräner Staaten. Man solle einen Streifen französischen Territoriums in einer Tiefe von zehn Kilometern ebenfalls entmilitarisieren und durch eine Kommission des Völkerbunds überwachen. Dieckhoff bat alle Missionen, die Ideen Cornwalls zu „verwerten“.[43]
Außerdem enthielt der Rundbrief Dieckhoffs eine Aufzeichnung mit dem Titel „Stichworte zur Frage der entmilitarisierten Rheinzone“. Die Denkschrift legte ausführlich die Haltung des Auswärtigen Amts zur Zone dar.[44] Die Rheinzone sei militärisch überholt, so hieß es da, und zeuge von einer bestimmten Geisteshaltung, deren Ziel sei, Deutschland am Boden zu halten. Die entmilitarisierte Zone sei insbesondere ein Instrument zur wirtschaftlichen Knebelung Deutschlands, weil im Rheinland bedeutende industrielle Kraftzentren lagen.
Das war die Situation bis Anfang März. Frage Rheinland. Noch kein Entschluss, notierte Joseph Goebbels (1897-1945) nach einem Treffen mit Hitler am 29.2.1936.[45] Doch dann ging alles rasend schnell. Am Morgen des 1.3.1936 erklärte Hitler, er sei nun entschlossen, Locarno zu „kündigen“ und das Rheinland zu remilitarisieren.[46] Damit stürzte er die bisherige Planung um und begann, das Unternehmen nach seiner Fasson aufzuziehen; es hatte mehrere Seiten.
Die erste Entscheidung des Reichskanzlers war, loszuschlagen, ohne einen günstigeren Moment abzupassen. Hitler wollte weder die Ratifizierung des französisch-sowjetischen Paktes durch den Senat abwarten noch die italienische Reaktion auf das Geschehen in Genf beobachten. Außerdem entschloss sich Hitler, die Beseitigung der entmilitarisierten Zone in einer militärischen Operation zu erzwingen.[47] Am 2. März stellte Hitler in der Reichskanzlei seine Pläne den Spitzen von Heer, Marine und Luftwaffe vor.

Einmarsch deutscher Truppen in Köln am 7. März 1936, Besprechnung auf der Deutzer Rheinseite, Foto: Julius Radermacher. (NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln / Sammlung Ewald (Bp 7305))
Die zweite Entscheidung bestand in dem Einfall, den Westmächten die Rückkehr Deutschlands in den Völkerbund anzubieten, um die Schockwellen des außenpolitischen Coups abzufedern.[48] Durch die Entscheidung, mit der deutschen Rückkehr nach Genf zu winken statt einen Viermächtepakt anzubieten, desavouierte der Reichskanzler das ursprüngliche Angebot zu einer neuen Sicherheitsordnung, wie es unter Beteiligung Neuraths am 19. Februar zu Stande gekommen war, zu Gunsten einer „Friedensoffensive“, die nur auf den propagandistischen Effekt abzielte.
Nach der Ministerrunde vom 2.3.1936 erging der Befehl zur überraschenden Besetzung der Rheinlandzone.[49] Am 3. März rief Hitler die Mitglieder des Kabinetts zu sich, um ihnen in Einzelgesprächen seine Pläne zur Remilitarisierung mitzuteilen.[50] Am 5. März unterzeichnete der Reichskanzler die Befehle für die Reichswehr und bestimmte Samstag, den 7. März, als Termin für die Aktion. Am selben Tag schickte das Auswärtige Amt das deutsche Memorandum an alle Locarnomächte. Am 6. März rief Hitler noch einmal das Kabinett zusammen, um die Gründe seines Entschlusses darzulegen.[51] Im Morgengrauen des 7.3.1936 marschierten die deutschen Truppen in die entmilitarisierte Zone. Lediglich drei Bataillone bewegten sich westwärts des Rheins in die Städte Aachen, Saarbrücken und Trier. Zu diesem Zeitpunkt saß Hitler schon im Sonderzug nach Berchtesgaden, wo er die Reaktionen der Westmächte erwartete.
Wieder einmal war die ganze Welt mit einer gewaltsamen Aktion aus der Ruhe gerissen. Wieder hielt die Welt den Atem an: Wie würden die anderen Mächte reagieren? Würde es nun zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen?

Einmarsch der Truppen in Köln am 7. März 1936 auf der Hohenzollernbrücke, Foto: J. Rademacher. (Rheinisches Bildarchiv/rba_mfL009490_73)
9. Die Reaktionen in England und Frankreich auf die Remilitarisierung des Rheinlands
Die Besetzung der entmilitarisierten Zone war eine unmittelbare Bedrohung für die Westmächte Frankreich und England. Blickt man jedoch auf die strategischen Konzeptionen, die die beiden Mächte seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten verfochten, wird deutlich, dass der Erhalt der Zone keine Rolle mehr spielte; eine kriegerische Aktion zur Wiederherstellung der entmilitarisierten Zone stand niemals zur Debatte.
Die britische Diplomatie hatte schon einige Wochen vor dem deutschen Schritt ins Rheinland begonnen, darüber nachzudenken, die entmilitarisierte Zone am Rhein als Preis für eine vertragliche Sicherheitsregelung mit dem Reich einzusetzen.[52] Ausgangspunkt waren die Stellungnahmen der Militärs über den Wert der entmilitarisierten Zone. Der Luftfahrtminister urteilte in einem Gutachten vom 27.1.1936, die Zone habe vom Standpunkt der Luftwaffe aus betrachtet keinen besonderen Wert. Bei einem deutschen Angriff könnten deutsche Bomber das Rheinland in wenigen Minuten überfliegen. Umgekehrt bilde sie kein Einfallstor für die Royal Air Force, weil Deutschland bereits Flugabwehreinheiten in der Zone stationiert habe. Ähnlich äußerte sich der Kriegsminister in einer Denkschrift vom selben Tag. Die entmilitarisierte Zone erschwere zwar die Verteidigung des Reiches und schränke die Möglichkeiten der deutschen Truppen ein, Frankreich in einem Überraschungsstreich zu überfallen, aber den größeren Nutzen habe Frankreich, nicht England.
Deutschland werde die Rheinlandzone so oder so abschaffen, kommentierte Ralph Wigram (1890-1936), ein hoher Beamter im Foreign Office, die britische Aufgabe müsse es sein, dafür zu sorgen, dass dies auf friedlichem Weg geschehe. Deshalb empfahl Wigram, England solle die Zone aufgeben, im Austausch für some little benefit, etwa den Abschluss eines Luftpaktes unter Einschluss Deutschlands.[53]

Einmarsch deutscher Truppen in Köln am 7. März 1936, Begrüßung vor dem Hotel Excelsior durch Oberbürgermeister Günther Riesen, Foto: Julius Radermacher. (NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln / Sammlung Ewald (Bp 7362))
Auf dieser Grundlage formulierte Außenminister Anthony Eden (1897-1977) seine Strategie. Sein Ziel sei, schrieb er am 11.2.1936, ein Arrangement mit Deutschland zu treffen. Er sei bereit, weitreichende Zugeständnisse zu machen, damit die Deutschen eine Abrüstungskonvention unterschreiben und in den Völkerbund zurückkehren würden. Man müsse sich aber klar darüber werden, was man Hitler im Gegenzug für seine Unterschrift bieten könne. Die britische Regierung, so lautete Edens Antwort, solle sich darauf einstellen, die entmilitarisierte Zone aufzugeben, solange Deutschland noch bereit sei, einen politischen Preis dafür zu bezahlen. Auf dieser Linie lag das Konzept, welches das Foreign Office in den folgenden Tagen ausarbeitete. Essenzielle Elemente, so eine Denkschrift des Foreign Office vom 15.2.1936, seien der Abschluss eines Luftpaktes unter Einschluss Hollands, das Verschwinden der entmilitarisierten Zone, eine Vereinbarung über die Begrenzung der Luftrüstungen und wirtschaftliche Zugeständnisse an Deutschland; schließlich könne man sich über ein Programm zur Reform des Völkerbundes einigen. Am 17.2.1936 beschloss das Cabinet Committee on Germany, auf dieser Basis die Verhandlungen mit Hitler zu eröffnen.[54]
Mit diesen Ideen setzten die Briten vor allem auf Zeitgewinn. Wigram, der mit seinen Äußerungen vom 9.1.1936, die britische Regierung solle beruhigend auf Paris und Berlin einwirken, um eine friedliche Abschaffung der Entmilitarisierungsbestimmungen zu erreichen, das Kabinett auf die Idee gebracht hatte, die entmilitarisierte Zone im Gegenzug für deutsche Leistungen im Bereich der Abrüstung aufzugeben, schrieb wenige Tage später, seine persönliche Ansicht sei, dass den britischen Interessen mit der Aufrechterhaltung des jetzigen Zustands am besten gedient sei. Das glaubte auch Robert Vansittart (1881-1957), Unterstaatssekretär im Außenministerium, der am 3.2.1936 erklärt hatte, die entmilitarisierte Zone sei eine Brennnessel, die man jäten müsse, bevor sie jemanden verbrenne. Man könne die Zone schon hergeben, grübelte er nun laut vor sich hin, wenn man sich klar darüber sei, was man dafür bekomme. Als sich die Deutschen die Zone mit einem Handstreich nahmen, hatten die Briten zwar ein Tauschobjekt verloren, aber wirklich erbost waren sie darüber nicht.
In der Zwischenzeit waren auch die Bestrebungen Frankreichs, die Rheinlandbesetzung zu verhindern, gescheitert.[55] Nach dem Abgang von Premierminister Pierre Laval (1883-1945) Ende Januar 1936 wurde eine Regierung unter Albert Sarraut (1872-1962) installiert. Von ihr wurde erwartet, dass sie die Geschäfte führte, bis die Wahlen im April und Mai eine neue mehrheitsfähige Regierung bringen würden. Pierre-Etienne Flandin (1889-1958), der Außenminister der neuen Regierung, konzentrierte seine Politik voll auf die Rheinzone. Ausgangspunkt seiner Strategie waren die Drohungen gegen die entmilitarisierte Zone, die nun beinahe täglich im Quai d’Orsay eintrafen. Am 10.12.1935 resümierte der Militärattaché in Berlin die Möglichkeit einer baldigen Besetzung der entmilitarisierten Zone. Die Reichswehrführung dränge auf die Abschaffung der Zone, so lautete sein Fazit, habe aber die Geduld, auf den richtigen Augenblick zu warten, weil technisch gesehen erst im Jahr 1937 der Punkt erreicht sei, an welchem die Einbeziehung der Zone für die weitere Aufrüstung notwendig sei. Andernfalls gab er zu bedenken, dass man sich in Berlin frage, ob nicht der Zeitpunkt günstig sei, unter Verweis auf den französisch-sowjetischen Beistandspakt die Rheinlandfrage durch ein Fait accompli zu lösen.
Zwei Wege standen den Franzosen in dieser Lage offen. Erstens die Möglichkeit, gestützt auf die französische Militärmacht gegen ein deutsches Fait accompli vorzugehen. Seit einer Inspektionsreise Marschall Philippe Pétains (1856-1951) in den nordöstlichen Grenzregionen im August 1935 erstellte der Generalstab die Pläne für den Fall einer plötzlichen Remilitarisierung des Rheinlandes durch Deutschland. Bereits Mitte September standen die ersten Planungen für Sofortmaßnahmen wie Grenzverstärkungen und schnellere Aufrüstung, die in den kommenden Monaten immer wieder überarbeitet wurden. Mit der Herausgabe eines umfassenden Maßnahmenkatalogs Mitte Februar 1936 waren diese Arbeiten abgeschlossen. Doch es gab einen Haken. Auf einer Sitzung des Militärkomitees am 18.2.1936 sagten die Militärs dem Außenminister offen ins Gesicht, dass sie über keine Pläne für eine deutsche Remilitarisierung des Rheinlandes verfügten: alle Operationspläne bezögen sich auf einen Angriff gegen das französische Kernland.[56] Blieb als zweite Möglichkeit die Schützenhilfe Großbritanniens. Bei einem Gespräch mit seinem britischen Amtskollegen erklärte Flandin, für die nahe Zukunft befürchte er eine deutsche Aktion im Rheinland, er wolle wissen, was England in diesem Fall zu tun gedenke. Eden erklärte ausweichend, als Erstes müsse sich Frankreich selbst überlegen, welchen Wert man der entmilitarisierten Zone beimesse. Bei dieser Haltung blieben die Briten in den folgenden Wochen. Der britische Botschafter in Paris, George Russell Clerk (1874-1951), mit dem Flandin noch Anfang Februar 1936 ausführlich über die entmilitarisierte Zone und die Schritte der französischen Politik gesprochen hatte, erhielt am 13. Februar die Anweisung aus London, sich auf keine hypothetischen Diskussionen mit den Franzosen über eine mögliche Remilitarisierung des Rheinlands einzulassen.[57]
Damit war der Gedanke einer großen Abwehrkoalition gegen die deutschen Rheinlandpläne an seiner Nahtstelle zerstört. Ohne den festen Willen der Militärs und ohne die Unterstützung der Briten blieb dem französischen Kabinett nichts Anderes übrig, als am 22.2.1936 den Beschluss zu fassen, im Falle einer deutschen Remilitarisierung des Rheinlands keine isolierte Militäraktion zu unternehmen, sondern den Völkerbundsrat in Genf anzurufen und weitergehende Schritte nur im Einvernehmen mit den Garanten Locarnos zu unternehmen. Das Ergebnis dieser Kabinettssitzung teilte Flandin am 27. Februar dem belgischen Vertreter in Paris und am 3. März dem britischen Außenminister in Genf mit. Die Option einer militärischen Antwort auf einen Gewaltstreich Hitlers war damit schon vor dem 7.3.1936 vom Tisch.

Einmarsch deutscher Truppen in Köln am 7. März 1936, vor dem Hotel Excelsior, Foto: Erich Kämmerer. (NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln / Sammlung Ewald (Bp 7364))
10. Schluss
Die Besetzung der entmilitarisierten Zone am Rhein am 7.3.1936 hat seit jeher die Historiker beschäftigt. Diese Aktion galt gemeinhin als entscheidender Wendepunkt auf dem Weg Nazideutschlands in den Weltkrieg. Tatsächlich zeigen neue Forschungen, dass England und Frankreich bereits lange vor der Aktion entschieden hatten, auf keinen Fall kriegerisch für den Erhalt der Zone einzutreten. Mag damit der Krisencharakter dieser Aktion überzeichnet sein, so bleibt dennoch festzuhalten, dass das Zurückweichen der Westmächte Hitler in seinen politischen Anschauungen bestärkte und damit deutlich krisenverschärfend auf die kommenden Aktionen wirkte.
Quellen
Die archivischen Quellen zu den diplomatischen und politischen Geschehnissen rund um die Rheinlandkrise 1936 befinden sich in den öffentlichen Archiven Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens, wobei die zentralen Aktengruppen im Bereich der Außenministerien und der Militärbehörden angesiedelt sind. In Deutschland sind das das Politische Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin (PA AA) und das Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg (BA-MA). In Frankreich werden die relevanten Akten im Archiv des Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères – Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve (CAD) sowie beim Service historique de la Défense (SHD) in Paris-Vincennes aufbewahrt. Die britischen Akten befinden sich in den National Archives in London-Kew (TNA). Für die Geschichte der entmilitarisierten Zone ist in den Landesarchiven der betroffenen Bundesländer reichhaltiges Quellenmaterial zu finden. Das Institut für Zeitgeschichte – Archiv (IfZ) verwahrt einige einschlägige Nachlässe sowie Zeugenaussagen zur Rheinlandkrise aus der Nachkriegszeit.
Gedruckte Quellen
Zahlreiche Quellen liegen in großen Akteneditionen vor. Für das Deutsche Reich:
Akten zur deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945 (ADAP); für Frankreich: Documents diplomatiques Français (DDF); für Großbritannien: Documents on British Foreign Policy 1918-1939 (DBFP.)
ADAP: Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Ser. C, 1933-1937, Band 1, 2: 16. Mai bis 14. Oktober 1933, Baden-Baden 1971; Band 4, 1: 1. April bis 13. September 1935, Baden-Baden 1975.
AdR: Akten der Reichskanzlei. Die Regierung Hitler 1933-1945, Band I, 1: 12. September bis 27. August 1934, bearb. v. Karl-Heinz Minuth, Boppard am Rhein 1983; Band III: 1936, bearb. v. Friedrich Hartmannsgruber, München 2002.
IMT: International Military Tribunal, Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Nürnberg, 14. November 1945 bis 1. Oktober 1946, Bände XV u. XXXIV, Nürnberg 1947.
NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit. Edition und Dokumentation, hg. v. Hans Bohrmann, Band 1: 1933, bearb. v. Gabriele Toepser-Ziegert, München 1984, ND 2015.
Picker, Henry, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941-1942, neu hg. v. Percy Ernst Schramm, Stuttgart 1963.
Die Tagebücher von Joseph Goebbels, im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte hg. v. Fröhlich, Elke, Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941, Band 3/I: April 1934-Februar 1936, bearb. v. Hermann, Angela, München [u.a.] 2005; Band 3/II: März 1936-Februar 1937, bearb. v. Jana Richter, München [u.a.] 2001.
Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung in der Gegenwart. Eine Urkunden- und Dokumentensammlung, Band 10: Die Errichtung des Führerstaates, die Abwendung von dem System der kollektiven Sicherheit, Berlin o. J.
Literatur (Auswahl)
Blaich, Fritz, Grenzlandpolitik im Westen 1926-1936. Die „Westhilfe“ zwischen Reichspolitik und Länderinteressen, Stuttgart 1978.
Braubach, Max, Der Einmarsch deutscher Truppen in die entmilitarisierte Zone am Rhein im März 1936. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des zweiten Weltkrieges, Köln/Opladen 1956.
Castellan, Georges, Le réarmement clandestin du Reich 1930-1935, Paris 1954.
Emmerson, James T., The Rhineland Crisis. 7th march 1936. A study in multilateral diplomacy, London 1977.
Evans, Richard, Das Dritte Reich, Band 2/II: Diktatur, München 2005.
Giro, Helmut-Dieter, Die Remilitarisierung des Rheinlands 1936. Hitlers Weg in den Krieg?, Düsseldorf 2006.
Haarfeldt, Mark, Deutsche Propaganda im Rheinland 1918-1936, Essen 2017.
Hoßbach, Friedrich, Zwischen Wehrmacht und Hitler 1934-1938, 2. Auflage, Göttingen 1965.
Matz, Reinhard/ Vollmer, Wolfgang, Köln vor dem Krieg. Leben, Kultur, Stadt 1880-1940, Köln 2012.
Mayer, Eugen, Die entmilitarisierte Zone am Rhein einst, jetzt und in Zukunft. Eine historisch-politische Skizze, Berlin 1928.
Meyers, Reinhard, Rhein und Ruhr als Objekte der Politik der europäischen Großmächte in den dreißiger Jahren, in: Düwell, Kurt/Köllmann, Wolfgang (Hg.), Rheinland-Westfalen im Industriezeitalter, Band 3: Vom Ende der Weimarer Republik bis zum Land Nordrhein-Westfalen, Wuppertal 1984, S. 7-20.
Ribbentrop, Joachim von, Zwischen London und Moskau. Erinnerungen und letzte Aufzeichnungen, aus dem Nachlass hg. v. Annelies von Ribbentrop, Leoni 1961.
Schmidt, Paul, Statist auf diplomatischer Bühne 1923–45. Erlebnisse des Chefdolmetschers im Auswärtigen Amt mit den Staatsmännern Europas, Bonn 1958.
Schmidt, Rainer F., Die Außenpolitik des Dritten Reiches 1933-1939, Stuttgart 2002.
Sollmann, Wilhelm, Die Beschränkung der Machtbefugnis Deutschlands durch den Friedensvertrag von Versailles, in: Schnee, Heinrich/ Draeger, Hans (Hg.), Zehn Jahre Versailles, Band 2: Die politischen Folgen des Versailler Vertrags, Berlin 1929, S. 1-24.
Vollmer, Bernhard, Volksopposition im Polizeistaat. Gestapo- und Regierungsberichte 1934-1936, Stuttgart 1957.
Wolz, Alexander, Das Auswärtige Amt und die deutsche Entscheidung zur Remilitarisierung des Rheinlands, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 63 (2015), S. 487-512.
Wolz, Alexander, Die Rheinlandkrise 1936. Das Auswärtige Amt und der Locarnopakt 1933-1936, München 2014.

Einmarsch der Truppen in Köln am 7. März 1936, Ecke Komödienstraße /Unter Fettenhennen, Foto: J. Rademacher. (Rheinisches Bildarchiv/rba_mfL009490_69)
- 1: Zu den Ereignissen am 7.3.1936 vgl. Braubach, Einmarsch; Emmerson, The Rhineland Crisis; Giro, Remilitarisierung, S. 67-86; Wolz, Rheinlandkrise, S. 427-433.
- 2: Tagebuch Luise Solmitz, zitiert nach Evans, Das Dritte Reich, S. 769.
- 3: Westdeutscher Beobachter, 9.3.1936, zitiert nach Matz/Vollmer, Köln, S. 305.
- 4: Matz/Vollmer, Köln, S. 306.
- 5: Vgl. Meyers, Rhein und Ruhr.
- 6: Zitiert nach Schmidt, Außenpolitik, S. 203.
- 7: Schmidt, Statist, S. 320.
- 8: Damit umfasste die entmilitarisierte Zone 56.092 Quadratkilometer und 15.357185, Einwohner, Mayer, entmilitarisierte Zone, S. 8.
- 9: Vgl. Sollmann, Beschränkung, S. 13-14.
- 10: Wolz, Rheinlandkrise, S. 36f.
- 11: Vgl. Wolz, Rheinlandkrise, S. 53.
- 12: Vgl. Mayer, entmilitarisierte Zone, S. 9-12.
- 13: Vgl. zum Folgenden Wolz, Rheinlandkrise, S. 104-110.
- 14: TNA FO 371/16279; CAD Serie Z, La rive gauche du Rhin, Band 281.
- 15: Polizeibesprechung im Innenministerium, 11.5.1933, Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 12 A, Nr. 24/3; AdR, Regierung Hitler, Band I, 1, Nr. 182, S. 639 Anm. 6; Weisung an die Presse, 8.8.1933, in: NS-Presseanweisungen, S. 89.
- 16: Vgl. Wolz, Rheinlandkrise, S. 101-104, 113-123.
- 17: ADAP, C, Band 1, 2, Nr. 490, S. 891-893; Ursachen und Folgen, Band 10, Nr. 2322, S. 34.
- 18: Aufzeichnung über eine Unterredung mit Max Jüttner, 8.5.1952, IfZ, ZS 251-1.
- 19: PA AA, R 33532.
- 20: Vgl. Castellan, Le réarmement, S. 348, 365, 395-397.
- 21: BA-MA, RH 2/25 und RH 2/1236.
- 22: Vgl. Wolz, Rheinlandkrise, S. 123-125.
- 23: Aufzeichnung Frohwein, 25.4.1934, PA AA, R 32239.
- 24: Neurath an Göring, 15.5.1934, AdR, Regierung Hitler, Band 1, 2, Nr. 347, S. 1273.
- 25: Vgl. Wolz, Rheinlandkrise, S. 140-142.
- 26: Aufzeichnung Frohwein, 7.5.1935, PA AA, R 33727; Aufzeichnung Bülow, 17.6.1935, PA AA, R 29456; weiteres Material in: PA AA, R 46941.
- 27: IfZ, ED 1, Band 1.
- 28: ADAP, C, Band 4, 1, Nr. 118, S. 226.
- 29: Vgl. Sollmann, Machtbefugnis, S. 14.
- 30: Vgl. etwa LAV NRW R Kreisausschuss Monschau BR 1005 Nr. 740; Regierung Aachen Präsidialbüro BR 0001 Nr. 1050.
- 31: Aufzeichnung: „Notwendigkeit der Einbeziehung des Ruhrgebiets zur Deckung des erhöhten Bedarfs der Wehrmacht an Rohstoffen“, 1934, BA-MA, RW 19/1760.
- 32: Denkschrift Terboven, 5.2.1936, PA AA, R 32041.
- 33: Vgl. Blaich, Grenzlandpolitik.
- 34: Bericht des Regierungspräsidenten, 4.12.1934, Vollmer, Volksopposition, S. 117-118.
- 35: Bericht der Staatspolizeistelle Aachen, 5.3.1936, Vollmer, Volksopposition, S. 359-360.
- 36: Vgl. Haarfeldt, Deutsche Propaganda.
- 37: Zitiert nach Wolz, Rheinlandkrise, S. 72.
- 38: IfZ, ED 91, Band 8, Grass an Geyr von Schweppenburg, 10.4.1950; Hoßbach, Zwischen Wehrmacht und Hitler, S. 83.
- 39: CAD, Série Relations multilatérales, Service français de la Société des Nations, Band 756, François-Poncet an Flandin vom 20.2.1936; NS-Presseanweisungen, Band 4/I, S. 160-161, Weisung an die Presse vom 13.2.1936.
- 40: PA AA, NL Forster, Band 1.
- 41: Goebbels, Tagebücher I, Band 3/I, S. 388, Eintragung vom 29.2.1936.
- 42: PA AA, R 31624, Aufzeichnung Roediger vom 21.2.1936.
- 43: PA AA, Botschaft Paris 660, Rundschreiben Dieckhoff vom 28.2.1936.
- 44: PA AA, R 32040, Aufzeichnung Gaus vom 10.2.1936.
- 45: Goebbels, Tagebücher I, Band 3/II, S. 29, Eintragung vom 1.3.1936.
- 46: Goebbels, Tagebücher I, Band 3/II, S. 30, Eintragung vom 2.3.1936. Vgl. die Aussage Alfred Jodls in Nürnberg, Hitler habe sich am 1. oder 2. März zur Besetzung des Rheinlands entschieden, IMT, Band XV, S. 386.
- 47: DDF, II, Band I, Nr. 417, S. 543-544, François-Poncet an Flandin, 13.3.1936.
- 48: Ribbentrop, Zwischen London und Moskau, S. 80.
- 49: IMT, Band XXXIV, S. 644-646.
- 50: Goebbels, Tagebücher I, Band 3/II, S. 32, Eintragung vom 4.3.1936; Aufzeichnung Picker vom 21.5.1942, in: Picker, Hitlers Tischgespräche, Nr. 129, S. 370.
- 51: AdR, Regierung Hitler, Band III, Nr. 39, S. 164-165.
- 52: Vgl. Wolz, Rheinlandkrise, S. 434-438.
- 53: DBFP, 2. Serie, Band XV, Nr. 455, S. 565.
- 54: TNA, CAB 24/259; DBFP, 2. Serie, Band XV, Nr. 522, S. 661-662.
- 55: Vgl. Wolz, Rheinlandkrise, S. 440.
- 56: SHD, 7 N 3437; vgl. Emmerson, Rhineland Crisis, S. 50-51.
- 57: DBFP, 2. Serie, Band XV, Nr. 484, S. 611 und Nr. 517, S. 652-653.
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.
Wolz, Alexander, Die Remilitarisierung des Rheinlands am 7. März 1936, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-remilitarisierung-des-rheinlands-am-7.-maerz-1936/DE-2086/lido/642bcedc0af097.30828046 (abgerufen am 27.04.2024)