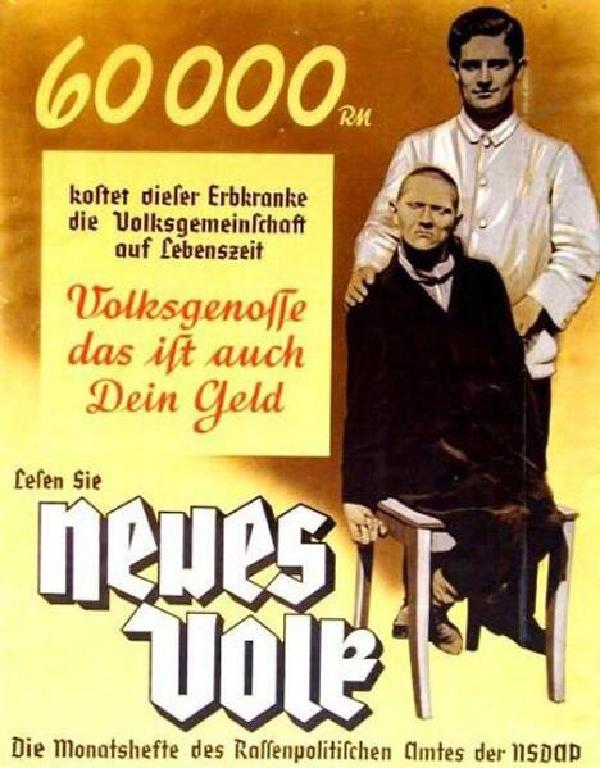Zu den Kapiteln
Schlagworte
1. Einleitung
Ein kleines Segment der kaum überschaubaren Sonderbehördenvielfalt des „Dritten Reiches“ will der folgende Beitrag erhellen: Organisation, Struktur und Aufgaben der „Bevollmächtigten für den Nahverkehr“, amtliches Kürzel Nbv. Der Begriff Nahverkehr war ein terminus technicus, der im Jahr 1931 durch die Dritte Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 6.10.1931[1] eingeführt und durch das Gesetz über den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen (GFG) vom 26.6.1935[2] sowie die zu diesem Gesetz erlassene Durchführungsverordnung (DVO-GFG) vom 27.3.1936[3]. Der Nahverkehr umfasste alle Transporte, die in der sogenannten Nahzone durchgeführt wurden und war im Gegensatz zum Güterfernverkehr zunächst genehmigungsfrei; zu dieser Nahzone gehörten alle Gemeinden innerhalb eines Umkreises von 50 Kilometern[4]. Die im Güternahverkehr eingesetzten Kraftfahrzeuge waren gemäß § 11 DVO-GFG mit einer entsprechenden Aufschrift zu kennzeichnen.
Die Aufgaben der Bevollmächtigten für den Nahverkehr umfassten bis zum Kriegsbeginn vornehmlich „die Sorge für die Aufrechterhaltung des Nahverkehrs“ für den Fall, dass „der Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen im Kriegsfalle völlig stillgelegt werden könne, und daß [nur] dem aufrecht zu haltenden Nahverkehr im wesentlichen Kraftfahrzeuge und Personal erhalten bleiben würden“[5]. Im Laufe des Krieges aber wurden die Aufgaben der Nbv erheblich ausgeweitet und erstreckten sich unter anderem auf die komplette Organisation des Straßenverkehrs, die Deckung des Bedarfs an Straßenverkehrsmitteln und deren Einsatz bei Großvorhaben sowie die Lenkung des Güter- und Personenverkehrs mit Kraftfahrzeugen, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Nbv übten von Anfang an „keine Friedensverwaltungstätigkeiten“ aus, sondern waren als „reine Mobilmachungsstellen“ angelegt[6]. Dies erklärt unter anderem auch, dass im Hinblick auf die Nbv, die seinerzeit als „geheime Reichssache“ eingestuft waren und deren Akten mehrheitlich gegen Kriegsende vernichtet wurden, die archivische Überlieferung dürftig ist und als deren Folge auch deren Berücksichtigung in der Forschung[7].
2. Die Errichtung der Nbv und ihre Entwicklung bis 1940
Durch gemeinsamen Runderlass vom 31.8.1936 übertrugen – „unter betontem Verzicht auf nach außen hin erscheinende Selbständigkeit“[8] – der Reichs- und Preußische Minister des Innern sowie der Reichs- und Preußische Verkehrsminister[9] mit Wirkung vom 1.10.1936 bestimmten Mittelbehörden, also mittelinstanzlichen Reichs- und preußischen Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung, in der Regel den Oberpräsidenten beziehungsweise den Zentralbehörden der Länder am Sitz einer Wehrkreisverwaltung, vorsorglich „die einheitliche Lenkung der noch vorhanden Straßenverkehrsmittel“. Gemeint war, „im Ernstfall alle Nahverkehrsmittel außer der Reichsbahn zentral zusammenzufassen und auf die Bedürfnisse der Wehrmacht einerseits, des zivilen Nahverkehrs anderseits einzustellen“.[10] Bei den Mittelbehörden wurden zunächst noch „Außenstellen des Reichs- und Preußischen Verkehrsministers“ genannte „Bevollmächtigte für den Nahverkehr (Nbv) und für jeden Nbv ein ‚ständiger Vertreter‘ bestellt“. Die Mittelbehörden wurden angewiesen, sich „bei der Durchführung der ihnen übertragenen Aufgaben dieser Bevollmächtigten zu bedienen. Die Nbv sind für die Durchführung dieser Aufgaben verantwortlich. Die Bezirke der Nbv decken sich mit den Wehrkreisen. […] Deshalb war es teilweise erforderlich, von den Grenzen der inneren Verwaltung abzuweichen. Etwa hierdurch auftretende Schwierigkeiten müssen durch enge Fühlungnahme überwunden werden.“ Die Nbv wurden den jeweiligen Mittelbehörden zugeteilt, erhielten ihre fachlichen Weisungen vom Reichsverkehrsminister, wurden aber verpflichtet, „den Leiter der Mittelbehörde über die wichtigen Fragen laufend zu unterrichten“. Die Nbv waren Dienststellen des Reiches, firmierten aber unter der Behörde, der sie angegliedert waren, zum Beispiel „Der Oberpräsident der Provinz Ostpreußen – Bevollmächtigter für den Nahverkehr“. Die Nbv unterstanden dem Reichsverkehrsminister, der den jeweiligen Behörden die persönlichen und sachlichen Kosten erstattete. Unbeschadet ihrer haushaltsrechtlichen und fachlichen Unterstellung unter den Reichsverkehrsminister wurden die Nbv Bestandteil der Behörde, bei der sie errichtet waren. Art und Umfang des Weisungsrechts des Leiters der jeweiligen Mittelbehörde gegenüber dem Nbv waren strittig und sind offenbar bis Kriegsende nicht definitiv geklärt worden. Der Reichsminister des Innern vertrat den Standpunkt, dass der Behördenleiter gegenüber dem Nbv in vollem Umfang weisungsberechtigt sei, konnte sich aber mit dieser Auffassung gegenüber dem Reichsverkehrsminister nicht durchsetzen.[11] Mit dem Errichtungserlass wurden die Mittelbehörden zudem angewiesen, für die zu errichtenden Nbv „einen Regierungsoberinspektor oder einen Regierungsinspektor mit kassenmäßiger Vorbildung […] namhaft zu machen“. Des Weiteren sollten ein Amtsgehilfe und zwei Schreibkräfte angenommen sowie ein Büro und „ein Unterkunftsraum für den Dienstkraftwagen“ bereitgestellt werden.[12] Die Bearbeitung der Personalien war zunächst nicht einheitlich geregelt, denn erst im Jahre 1940 ordnete der Reichsverkehrsminister an, dass diese, „wie es schon bei mehreren Nbvs geschieht, von den Regierungen, Oberpräsidenten, Reichsstatthaltern bzw. Landesregierungen zu bearbeiten sind, denen der Nbv angegliedert ist“.[13] Die Entscheidung, dass die Wehrkreise (zunächst) den Zuständigkeitsbereich der Nbv bilden sollten, die nicht immer mit sonstigen Verwaltungsgrenzen übereinstimmten, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass „die nach 1933 einsetzende verkehrswirtschaftliche Gesetzgebung und vor allem die Vorbereitung der Mobilmachung“ dazu führte, „daß der Straßenverkehr nach großräumigeren Verwaltungsbezirken verlangte. Die Handhabung des Güter- und Personenverkehrsgesetzes kann sinnvoll nur bei denjenigen Behörden stattfinden, denen auch die Vorbereitung der Mobilmachung obliegt“.[14]
Zum Zeitpunkt der Errichtung der Nbv gab es im Reichsgebiet zwölf Wehrkreise.[15] Am Sitz der Wehrkreise (mit einer Ausnahme) wurden als Außenstellen des Reichs- und Preußischen Verkehrsministers Bevollmächtigte für den Nahverkehr errichtet im Wehrkreis I beim Oberpräsidenten der Provinz Ostpreußen in Königsberg i.Pr., im Wehrkreis II beim Oberpräsidenten der Provinz Pommern in Stettin, im Wehrkreis III beim Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg in Berlin, im Wehrkreis IV beim Sächsischen Minister des Innern in Dresden, im Wehrkreis V beim Württembergischen Innenminister in Stuttgart, im Wehrkreis VI beim Oberpräsidenten der Provinz Westfalen in Münster und beim Regierungspräsidenten in Düsseldorf, im Wehrkreis VII beim Bayerischen Staatsminister des Innern in München, im Wehrkreis VIII beim Oberpräsidenten der Provinz (Nieder-)Schlesien in Breslau, im Wehrkreis IX beim Oberpräsidenten der Provinz Hessen-Nassau in Kassel, im Wehrkreis X beim Reichsstatthalter in Hamburg – Senat –, im Wehrkreis XI beim Oberpräsidenten der Provinz Hannover in Hannover, im Wehrkreis XII beim Regierungspräsidenten in Wiesbaden.
In der Folgezeit gab es mehrere Änderungen in der Einteilung der Wehrkreise, die sich teilweise auf den Bestand der Nbv-Organisation auswirkte. Im Oktober 1937 wurden die Wehrersatzbezirke aus dem Wehrkreis VII (München) ausgegliedert und mit einigen Gebieten aus dem Wehrkreis V (Stuttgart) zu einem neuen Wehrkreis XIII mit Sitz in Nürnberg zusammengefasst. Der neu errichtete Nbv firmierte zunächst als Außenstelle des Staatsministers des Innern in Nürnberg-Fürth. Mit dem Anschluss Österreichs wurden in den zum 1.4.1938 neu errichteten Wehrkreisen XVII (Sitz Wien) und XVIII (Sitz Salzburg) Nbv errichtet für den Wehrkreis XVII zunächst beim Reichsstatthalter in Österreich – Landesregierung – und für den Wehrkreis XVIII zunächst beim Landeshauptmann in Salzburg (ab 1940 bei den Reichsstatthaltern in Wien beziehungsweise Salzburg). Die im Herbst 1938 annektierten sudetendeutschen Gebiete wurden in die Wehrkreise VIII (Breslau), IV (Dresden) und XIII (Nürnberg) eingegliedert. Erst im Juni 1944 wurde beim Reichstatthalter in Reichenberg ein eigener Nbv für den Reichsgau Sudetenland errichtet. In den im Oktober 1939 angegliederten Gebieten Danzig-Westpreußen und Wartheland wurden die Wehrkreise XX (Danzig) und XXI (Posen) errichtet, deren Nbv jeweils den Reichsstatthaltern in Danzig und Posen beigegeben wurden. Im Rahmen der Organisation der Wehrwirtschaftsverwaltung waren einige Wehrkreise in zwei Wehrwirtschaftsbezirke aufgeteilt.[16] Für die Nbv-Organisation wirkte sich dieses in den Wehrkreisen V (Stuttgart) und IX (Kassel) aus[17], nachdem der Reichsverkehrsminister festgestellt hatte, in diesen Wehrkreisen sei es „notwendig geworden, die bisherige Gliederung der Nbv-Bezirke abzuändern und bei weiteren Mittelbehörden Nbv einzusetzen“.[18] Beim Nbv Stuttgart verblieben aus dem Wehrkreis V die württembergischen Gebiete und der Regierungsbezirk Sigmaringen (Wehrwirtschaftsbezirk Va), während ab Mai 1940 für die badischen Gebiete (Wehrwirtschaftsbezirk Vb) ein neuer Nbv beim Badischen Innenminister in Karlsruhe errichtet wurde. Im Wehrkreis IX verblieben die Gebiete der Provinz Hessen-Nassau, des Landes Hessen sowie die bayerischen, hannöverschen und westfälischen Kreise (Wehrwirtschaftsbezirk IXa) beim Nbv Kassel, während für das Land Thüringen, den Regierungsbezirk Erfurt und den Kreis Schmalkalden (Wehrwirtschaftsbezirk IXb) ein neuer Nbv beim Thüringischen in Weimar eingesetzt. Über die Einsetzung von Nbv in außerdeutschen Gebieten und die Neuordnung der innerdeutschen Nbv-Bezirke wird in Abschnitt 3 dargestellt.
Als Außenstellen des Reichsverkehrsministers bildeten die Bevollmächtigten für den Nahverkehr im Reichsverkehrsministerium einen eigenen Dienstbereich neben beispielsweise der Eisenbahn oder den Wasserstraßen. Ab Mitte der 1930er Jahre war für Kraftverkehr und Straßenverkehr (unter dieser Bezeichnung spätestens 1938 nachgewiesen) eine eigene Abteilung „K“ im Ministerium zuständig. In der Abteilung K lag die Zuständigkeit für die Nbv zunächst beim Referat K 3 (ab 1939 K 9) mit folgenden Arbeitsgebieten: Nbv-Organisation; Reichsleistungsgesetz; Ausgleich von Fahrzeugen innerhalb des Reichs; Freistellung von Fahrzeugen gegenüber der Wehrmacht und Verteilung der von ihr an die Wirtschaft zurückkommenden Verkehrsmittel; Sicherstellung des für die Straßenverkehrsunternehmen erforderlichen Personals; Einsatz der Straßenverkehrsmittel.[19] Die im Zusammenhang mit den Nbv Reichsverteidigungsangelegenheiten war zunächst einer – allerdings mit der Abteilung K schon personell verflochtenen – eigenständigen Gruppe für Reichsverteidigung (LV)[20] übertragen, bis diese dann der Abteilung K zugewiesen wurden, in der „Reichsverteidigung und Organisation der Straßenverkehrsverwaltung“ dann eine gleichnamige Gruppe von fünf Referaten bildeten.[21] Diese Gruppe wurde spätestens 1943 aufgelöst, die weiterhin fünf Referate unmittelbar dem Abteilungsleiter unterstellt.[22] Mit dem Vierjahresplan bestand zeitweise eine unmittelbare personelle Verzahnung mit der Abteilung K. Der im November 1938 durch den Beauftragten für den Vierjahresplan zum Generalbevollmächtigten für das Kraftfahrwesen (GBK) ernannte Oberst[23] Adolf von Schell[24] wurde am 1.3.1940 „als Unterstaatssekretär mit außergewöhnlichen Vollmachten in das Reichsverkehrsministerium“ eintrat und zugleich Leiter der Abteilung K wurde[25] und in dieser Stellung bis Mitte 1942 verblieb. Der Beauftragte für den Vierjahresplan, Ministerpräsident Generalfeldmarschall Hermann Göring (1893-1946), rühmte diese Personalentscheidung als „entscheidende[n] Schritt zur einheitlichen Betreuung und Ausrichtung des motorisierten Verkehrs […], der gleichermaßen für Wehrmacht, Wirtschaft und allgemeinen Straßenverkehr von Bedeutung ist“.[26]
3. Innere Organisation, Zuständigkeiten und Personal
Zur inneren Verfassung, also zur Geschäftsverteilung bei den Bevollmächtigten für den Nahverkehr, hat, soweit ersichtlich, der Reichsverkehrsminister erstmals im Oktober 1939 Bestimmungen erlassen.[27] Nachdem die Tätigkeit der Nbv „nunmehr auf den Krieg umgestellt ist, erscheint es zweckmäßig, eine einheitliche Verteilung der aufkommenden Geschäfte innerhalb Ihrer Dienststelle vorzunehmen“. Ein beigefügter Mustergeschäftsverteilungsplan sah die folgenden Arbeitsgebiete für die Nbv vor:
- Allgemeine Verwaltung und Kassenangelegenheiten
- Personaleinsatz und -ersatz
- Einsatz der Güternahverkehrsmittel (einschließlich Pferde)
- Einsatz der Güterfernverkehrsmittel (auch für Sonderaufgaben)
- Personenverkehr
- Spedition und Lagerei
- Einsatz der Personenbeförderungsmittel
- Treibstoffangelegenheiten
- Angelegenheiten für Reparaturen und Ersatzteile.
Auf diesen Vorgaben beruhte der Geschäftsverteilungsplan des Nbv Düsseldorf vom 1.1.1940[28]: Dezernat I Verwaltung (mit zwei Sachgebieten [1, 2]) Dezernat II Gütertransport (mit drei Sachgebieten [3, 4, 6] Dezernat III Personenbeförderung (mit zwei Sachgebieten [5, 7]) Dezernat IV Betriebswirtschaft und -technik (mit zwei Sachgebieten [8, 9]) Diese Aufteilung der Arbeitsgebiete bezeichnete der Reichsverkehrsminister bereits zwei Jahre später als „durch die Ausweitung der Aufgaben [der Nbv] überholt“ und erließ eine neue Mustergeschäftsverteilung, die mit elf beziehungsweise ab Frühjahr 1942 (mit Hinzukommen der Straßenbahnaufsicht) zwölf Arbeitsgebiete/Dezernate umfasste.[29] Die Geschäftsverteilung änderte sich in der Folgezeit nur noch unwesentlich, wie der letzte überlieferte Geschäftsverteilungsplan („vorläufige Dezernatseinteilung“) des Nbv Düsseldorf, Stand 22.2.1945, belegt.[30] Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Personal- und Kassenangelegenheiten Dezernat II Rechtsangelegenheiten, Bezugsscheinangelegenheiten usw. Dezernat III Güterbeförderung im Nahverkehr Dezernat IV Güterbeförderung im Fernverkehr Dezernat V Personenverkehr Dezernat VI Allgemeine Straßenbahnangelegenheiten, technische Straßenbahnaufsicht Dezernat VII Beförderungsentgelte Dezernat VIII Fahrzeugtechnik und Umbau auf heimische Kraftstoffe Dezernat IX Betriebsstoffe, Tankstellen Dezernat X Personalwirtschaft Dezernat XI Sicherstellung von Verkehrsmitteln Dezernat XII Verkehrsorganisation und -planung
Die Durchführung der Tätigkeiten der Nbv vor Ort erfolgte durch die Fahrgemeinschaftsleiter. Diese waren nachgeordnete Dienststellen der Bevollmächtigten für den Nahverkehr (Nbv) und wurden im Februar 1941 in die unteren Verwaltungsbehörden (Stadt- und Landkreise) eingegliedert, in Krefeld beispielsweise an das Amt 79 – Wirtschaftsamt und Ernährungsamt Abt. B.[31] Das genaue Datum der Einsetzung der Fahrbereitschaftsleiter ist nicht bekannt; im Oktober 1939 waren Fahrbereitschaftsleiter offenbar schon „bei den unteren Verwaltungsbehörden“ eingesetzt.[32] Eine umfassende Dienstanweisung für die Fahrbereitschaftsleiter veröffentlichte der Reichsverkehrsminister erst am 10.6.1942.[33] In bestimmten Gebieten konnten mehrere Fahrbereitschaften zu einer Gruppenfahrbereitschaft zusammengeschlossen werden.
In den Reichsverteidigungsbezirken, in denen keine Nbv eingesetzt waren, waren ab Mai 1944 Bezirksfahrbereitschaftsleiter einzusetzen, deren Zuständigkeitsbezirk sich auf den jeweiligen Reichsverteidigungsbezirk erstreckte. Die Bezirksfahrbereitschaftsleiter waren bei der geschäftsführenden Behörde des Reichsverteidigungskommissars zu bestellen und führten ihre Geschäfte unter dessen Bezeichnung mit einem entsprechenden Zusatz, Beispiel: Der Reichstatthalter in Oldenburg und Bremen – Bezirksfahrbereitschaftsleiter.[34] Den Bezirksfahrbereitschaftsleitern wurden im Einzelnen die folgenden Aufgaben übertragen[35]:
- Einheitliche Ausrichtung der Maßnahmen zur Durchführung des Straßenverkehrs in seinem Bezirk.
- Fahrzeugausgleich bei Transportaufgaben, die über das Leistungsvermögen einer Gruppenfahrbereitschaft oder Fahrbereitschaft hinausgehen.
- Vorbereitung der Durchführung von Soforthilfemaßnahmen, soweit sie nicht in das Aufgabengebiet der Partei fallen; hierzu beruft der Reichsverteidigungskommissar [Gauleiter] den Bezirksfahrbereitschaftsleiter als Vertreter des Bevollmächtigten für den Nahverkehr in den Gaueinsatzstab.
- Laufende Unterrichtung des Reichsverteidigungskommissars und des Leiters der geschäftsführenden Behörde des Reichsverteidigungskommissars über die Verkehrslage und über wichtige Ereignisse.
- Sonderaufträge des Nbv.
Die Bezirksfahrbereitschaftsleiter übten innerhalb ihres Bezirks gleichsam Funktionen eines Nbv aus, obwohl sie in der behördlichen Hierarchie dem Nbv unterstellt blieben. Die Einsetzung der Bezirksfahrbereitschaftsleiter ist letztlich als Konzessionen gegenüber den Gauleitern als Reichsverteidigungskommissaren zu werten, in deren Bezirk kein Nbv bestand. Nähere Unterlagen über die Einsetzung der Bezirksfahrbereitschaftsleiter ließen sich nicht ermitteln. Im Rheinland und in Westfalen kamen nur zwei Reichsverteidigungsbezirke für die Einsetzung eines Bezirksfahrbereitschaftsleiters in Betracht: der Reichsverteidigungsbezirk Köln-Aachen (geschäftsführende Behörde Regierungspräsident Köln) und Reichsverteidigungsbezirk Westfalen-Süd (geschäftsführende Behörde Regierungspräsident Arnsberg). Der Reichsverteidigungsbezirk Essen hatte zwar in seinem Bezirk keinen Nbv, seine geschäftsführende Behörde war aber der Regierungspräsident Düsseldorf, zudem war Essen Sitz eines bezirksübergreifenden Sonderreferats Ruhr.
Bei den als Bevollmächtigte für den Nahverkehr eingesetzten Beamten handelte es bis zum Kriegsausbruch 1939 mehrheitlich um eine recht homogene Beamtengruppe.[36] Alle 1936 als Nbv oder deren Stellvertreter bestellten Beamten waren zur Dienstleistung bei der jeweiligen Verwaltungsbehörde abgeordnete Beamte des höheren Dienstes, vereinzelt auch des gehobenen und höheren Dienstes der Deutschen Reichsbahn (vor allem Reichsbahnräte, Reichsbahnassessoren). Die meisten dieser Beamten waren etwa zwischen 30 und 40 Jahre alt und standen am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn. Soweit sie sich 1938 dafür entschieden, bei der Organisation der Nbv zu verbleiben, wurden sie als Regierungsbauräte - vereinzelt auch Regierungsräte - in den unmittelbaren Reichsdienst übernommen. Auch wenn einzelne Beamte bei den Nbv von „ungeklärten Entwicklungsmöglichkeiten“ (Walter Wetzler, München) oder gar von einem „Abstellgleis“ (Albrecht Zahn, Stuttgart) sprachen, haben sich offenbar nach der Konsolidierung der Nbv-Organisation die beruflichen Perspektiven verbessert und dazu geführt, dass als Nbv tätige Beamte gefragte Spezialisten wurden, für die geeigneter Nachwuchs nicht ohne weiteres verfügbar war. Dies zeigt, dass mancher Nbv nach anderer Verwendung wieder an seine ursprüngliche Nbv-Dienststelle zurückkehrte oder ein Nbv im Laufe seiner Dienstzeit bei verschiedenen Nbv zum Einsatz kam. Wie eng die Personaldecke letztlich war, zeigt auch der Einsatz einzelner Beamter der Deutschen Reichspost, von Funktionären des NSKK und sogar eines Konsistorialrats bei Dienststellen der Nbv. Nicht zuletzt war für einige Beamte ihre Nbv-Tätigkeit ein Sprungbrett für ihre weitere Karriere: Erwin Deischl (1904-1984)[37] und Walther Wetzler (1898-1960)[38] wurden (nebst einigen anderen Nbv) später in das Reichsverkehrsministerium übernommen, wobei Wetzler zuletzt Ministerialdirektor und Leiter der Abteilung K (Kraftverkehr) wurde. Auch für Nachkriegskarrieren waren Tätigkeiten als Nbv nicht unbedingt schädlich, wie einige Beispiele zeigen. Der bereits erwähnte Walter Wetzler war in der Straßenverkehrsverwaltung der britischen Zone beziehungsweise des Vereinigten Wirtschaftsgebietes sowie im Bundesministerium für Verkehr an leitender Stelle tätig, später dann als Präsident des Oberprüfungsamtes für die höheren technischen Verwaltungsbeamten. Der Jurist Franz Wessel (1903-1958), Nbv Berlin und Krakau, brachte es nach Tätigkeit in der Straßenverkehrsverwaltung und beim Bundesrat bis zum Richter am Bundesverfassungsgericht. Der zeitweilige Hamburger Nbv Hans von Heppe (1907-1982)[39] machte nach 1945 in der Kultusverwaltung von Nordrhein-Westfalen und in Hamburg Karriere, die er mit dem Amt des Staatssekretärs im Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung beziehungsweise für Bildung und Wissenschaft (1966-1971) abschloss. Zwei der Nbv im Wehrkreis XIII (Nürnberg-Fürth), Otto Liegel (1902-1983)[40] und Karl Parigger (geboren 1909)[41] wurden in den 1950er Jahren nacheinander Leiter des Kraftfahrbundesamtes in Flensburg.
4. Die Entwicklung der Nbv-Organisation ab 1939/1940
a) Annektierte und besetzte Gebiete
Der erste Nbv, der außerhalb des eigentlichen Reichsgebiets eingesetzt wurde, war der Mitte 1939 dem Reichsprotektor für Böhmen und Mähren in Prag angegliederte und für das Gebiet des Protektorats zuständige Nbv. Kurzlebig waren die Nbv, die bei den Kriegsvorbereitungen 1938 (etwa gegenüber der Tschechoslowakei sowie beim Bau des Westwalls) tätig waren, ebenso wie die bei den Armeeoberkommandos oder Militärbefehlshabern im Polenfeldzug beigeordneten CdZ-Stäben eingesetzten Nbv. Letztere wurden bereits im Oktober 1939 als reguläre Nbv in den Wehrkreisen XX (Danzig-Westpreußen) und XXI (Wartheland) sowie bei dem Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete in Krakau umgewandelt. Weitere eingegliederte Gebiete, wie der Regierungsbezirk Zichenau oder Ostoberschlesien kamen zu den Wehrkreisen I und VIII und den in ihnen errichteten Nbv. Weitere kurzlebige Nbv-Dienststellen gab es auch 1939/1940 bei den Chefs der Zivilverwaltung im innerdeutschen Operationsgebiet im Westen, ohne dass diese jedoch später in reguläre Nbv umgewandelt wurden.[42] Die genannten Chefs der Zivilverwaltungen hatten im Wesentlichen die Aufgabe, als Verbindungsstelle zwischen den militärischen Befehlshabern und den Zivilbehörden zu fungieren, keinesfalls aber laufende Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.[43] Im Gegensatz hierzu hatten – trotz des gleichen Namens – die Chefs der Zivilverwaltungen, die in bestimmten, für eine spätere Eingliederung in das Reich vorgesehenen Grenzgebieten im Westen (Elsass, Lothringen, Luxemburg), Südosten (Untersteiermark und Kärnten-Krain) und Osten (Bialystok) für die sukzessive Angleichung an das deutsche Verwaltungs- und Rechtssystem Sorge zu tragen.[44] Zu unmittelbar dem Führer unterstehenden Chefs der Zivilverwaltung wurden im Westen am 2.8.1940 die Gauleiter benachbarter NSDAP-Gaue ernannt. Diese Gebiete sollten aus außenpolitischen Gründen zunächst nicht völkerrechtlich annektiert werden, die französische Regierung sprach aber zutreffend von einer „annexion déguisée“.[45] Auch wenn diese CdZ-Gebiete in die Wehrkreise V (Stuttgart) und XII (Wiesbaden) einbezogen wurden, erfolgte keine Einbeziehung in die jeweiligen Nbv-Bezirke. Stattdessen wurden im Herbst 1940 bei den Chefs der Zivilverwaltung im Elsass ein Nbv in Straßburg (mit dem Nbv Karlsruhe in Personalunion verbunden) und in Luxemburg ein Nbv eingesetzt. Ein Nbv für Lothringen indes wurde bei der Behörde des Reichskommissars für die Saarpfalz mit Sitz in Saarbrücken errichtet, der aber nur für Lothringen zuständig war. Als nachgeordnete Einrichtungen der in den CdZ-Gebieten eingesetzten Nbv waren Fahrbereitschaftsleiter eingesetzt: im Elsass bei den Oberstadtkommissaren (Oberbürgermeistern) in Colmar, Mülhausen und Straßburg sowie bei den Landkommissaren (Landräte) in Altkirch, Erstein, Gebweiler, Hagenau, Molsheim, Rappoltsweiler, Schlettstadt, Thann, Weißenburg und Zabern; in Lothringen beim Stadtkommissar (Oberbürgermeister) in Metz und den Landkommissaren in Diedenhofen, Saarburg, Saargemünd, Salzburgen und St. Avold; in Luxemburg in der Stadt Luxemburg und in den Landkreisen Esch, Diekirch und Grevenmacher.[46]
Nach dem 14.4.1941 wurden in Kärnten-Krain und Untersteiermark keine eigenen Nbv eingesetzt, weil der Reichsverkehrsminister die Verwaltung von Anfang an nach „den im Reich herrschenden Grundsätzen“ in eigener Verantwortung zu führen hatte.[47] Kärnten-Krain und Untersteiermark kamen zum Bezirk des Nbv Salzburg, allerdings wurden den Dienststellen der CdZ „Beauftragte für den Nahverkehr“ beigegeben, deren Aufgaben von den Gruppenfahrbereitschaftsleitern in Graz beziehungsweise Krainburg wahrgenommen wurden. Es bestanden folgende Fahrbereitschaftsleiter: in Kärnten-Krain in Krainburg, Radmannsdorf, Stein, Unterdrauburg (bildeten die Gruppenfahrbereitschaft Krainburg); in Untersteiermark in Marburg-Stadt, Marburg-Land, Oberradkersburg, Pettau, Cilli, Trefail, Rann (bildeten die Gruppenfahrbereitschaft Marburg).[48] Ebenfalls wurde für das Gebiet des am 17.7.1941 eingesetzten Chefs der Zivilverwaltung in Bialystok[49] kein eigener Nbv eingesetzt; Bialystok wurde vom Nbv in Königsberg betreut.
In Norwegen und den Niederlanden, wo jeweils eine deutsche Aufsichtsverwaltung unter einem Reichskommissar eingesetzt war, bestanden auch dem Nbv vergleichbare Dienststellen, in Norwegen (Sitz Oslo) Straßenverkehrsreferent beziehungsweise Verkehrsabteilung genannt[50], in den Niederlanden Nbv mit Sitz in Den Haag, ab 1943 Zeist bei Utrecht.[51] Bei den Militärverwaltungen in Belgien-Nordfrankreich, den besetzten französischen Gebieten und in Serbien waren Nbv eingesetzt, teils mit weiteren nachgeordneten Nbv und/oder Fahrbereitschaftsleitern bei den (Ober-)Feldkommandanturen und Militärverwaltungsbezirken. In den besetzten Ostgebieten war eine eigene (Straßen-)Verkehrsverwaltung mit einer Generalverkehrsdirektion Osten in Warschau, Reichsverkehrsdirektionen in Riga, Minsk, Kiew und Dnjepropetrowsk mit nachgeordneten Reichs-Straßenverkehrsämtern und Reichs-Straßenverkehrsstellen.[52]
b) Reichsgebiet
Die seit langem angekündigte Neuorganisation der Bezirke der Wirtschaftsverwaltung wurde durch die Verordnung über die Reichsverteidigungskommissare und die Vereinheitlichung der Wirtschaftsverwaltung vom 16.11.1942[53] verwirklicht. Grundlage der neuen Bezirkseinteilung waren die NSDAP-Parteigaue, die auch zu Reichsverteidigungsbezirken und Wirtschaftsbezirken wurden und somit zugleich den Charakter staatlicher Verwaltungsbezirke erhielten. Die neue Einteilung orientierte sich zugleich mehr an bestehenden Verwaltungsgrenzen als die bisherigen Wehrkreisgrenzen, da die Parteigaue auf dem Zuschnitt der Reichstagswahlkreise fußten. § 12 Abs. 1 der Verordnung bestimmte: „Die örtliche Zuständigkeit der Bevollmächtigten für den Nahverkehr umfaßt einen oder mehrere Wirtschaftsbezirke oder Teile von Wirtschaftsbezirken.“ Nach § 8 Abs. 2 gehörte der Nbv ferner dem Verteidigungsausschuss des Reichsverteidigungskommissars an. Die Verordnung trat zwar zum 1.12.1942 in Kraft, die Obersten Reichsbehörden wurden jedoch in § 22 Abs. 1 ermächtigt, auch hiervon abweichend einen Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem Änderungen in der gebietlichen Zuständigkeit der Ämter und Dienststellen ihres Ressorts durchzuführen waren. Der Reichsverkehrsminister setzte die für die Nbv ergebenden Gebiets- und organisatorischen Änderungen erst durch Durchführungsanordnung vom 30.3.1943[54] mit Wirkung vom 1.4.1943 in Kraft. Die insgesamt elf Arrondierungen der Nbv-Bezirke betrafen im Wesentlichen die Aufhebung von Inkongruenzen der Wehrkreisgrenzen mit den Grenzen der höheren Verwaltungsbehörden. So kamen beispielsweise die Stadt- und Landkreise der Provinz Westfalen, die bislang den Nbv Düsseldorf und Kassel zugeteilt waren, zum Nbv Münster, der seinerseits den Regierungsbezirk Osnabrück an den Nbv Hannover abzugeben hatte, des Weiteren wurden zu Nbv-Bezirken zusammengefasst das Elsass und Baden mit dem Nbv beim Minister des Innern in Karlsruhe[55], Lothringen, das Saarland und die Pfalz [Saarpfalz (Westmark)] mit dem Nbv beim Reichsstatthalter in der Westmark und Chef der Zivilverwaltung in Lothringen in Saarbrücken, Luxemburg und die Regierungsbezirke Koblenz und Trier mit dem Nbv beim Regierungspräsidenten in Koblenz[56]. Ferner bestimmte die Anordnung, dass, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt, zusätzliche Nbv-Dienststellen errichtet werden sollten beim Oberpräsidenten in Magdeburg für die Regierungsbezirke Magdeburg, Merseburg und das Land Anhalt, beim Oberpräsidenten in Kattowitz für die Provinz Oberschlesien und beim Reichsstatthalter in Reichenberg für den Reichsgau Sudetenland. Die Einsetzung dieser Nbv sollte jeweils gesondert angezeigt werden, bis dahin waren deren Aufgaben in den Regierungsbezirken Magdeburg, Merseburg und im Land Anhalt vom Nbv in Hannover, in der Provinz Oberschlesien vom Nbv in Breslau im Sudetenland vom Nbv in Dresden erledigt worden. Der Nbv in Reichenberg wurde durch Runderlass vom 21.6.1944 eingesetzt[57], der Nbv in Kattowitz zum 1.2.1945[58]; letzterer hat aber seine Arbeit offenbar nicht mehr aufnehmen können.
5. Die besondere Situation im Wehrkreis VI beziehungsweise in der übrigen Rheinprovinz
a) Wehrkreis VI
Wie gezeigt, war der Wehrkreis VI der einzige Wehrkreis, in dem von Anfang an zwei Nbv errichtet wurden für den nordöstlichen Teil beim Oberpräsidenten in Münster und für den südwestlichen Teil beim Regierungspräsidenten in Düsseldorf. Der Wehrkreis VI umfasste die Provinz Westfalen (ohne die Kreise Siegen, Wittgenstein), die Regierungsbezirke Aachen, Düsseldorf, Köln, Osnabrück, das Land Lippe und das Land Schaumburg-Lippe (ab 1939 zum Wehrkreis XI). Zum Bezirk des Nbv Münster gehörten der Regierungsbezirk Münster (ohne Landkreis Recklinghausen und die Stadtkreise Recklinghausen, Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen-Buer), vom Regierungsbezirk Arnsberg die Kreise Arnsberg, Meschede, Brilon, Soest und Lippstadt, die Regierungsbezirke Minden und Osnabrück, das Land Lippe und bis 1939 Schaumburg-Lippe. Der Nbv Düsseldorf war zuständig für die Regierungsbezirke Aachen, Düsseldorf und Köln, vom Regierungsbezirk Münster den Landkreis Recklinghausen und die Stadtkreise Recklinghausen, Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen-Buer, vom Regierungsbezirk Arnsberg die Stadtkreise Hamm, Lünen, Dortmund, Iserlohn, Lüdenscheid, Bochum, Wattenscheid, Witten, Herne, Castrop-Rauxel, Wanne-Eickel, Hagen, die Landkreise Unna, Iserlohn, Olpe, Altena, der Ennepe-Ruhr-Kreis.
Anlass für diese recht ungewöhnliche, die Grenzen der höheren Verwaltungsbezirke missachtende Abgrenzung der Nbv-Bezirke Düsseldorf und Münster war vermutlich die Absicht, „das Ruhrgebiet in verkehrstechnischer Hinsicht nicht zerschneiden zu wollen“.[59] Dies ist nachvollziehbar, lässt aber die Frage offen, warum bei der Abgrenzung nicht die Grenzen des Siedlungsverbands Ruhrkohlenbezirk übernommen wurden, sondern diese im Osten und Südosten noch überschritten wurden. In jedem Fall sah spätestens mit der Einführung der Wehrwirtschaftsverwaltung im September 1939 mit ihren Bezirkswirtschaftsämtern (Wehrwirtschaftsbezirke VIa und VIb), die den herkömmlichen Bezirksgrenzen entsprachen, der Oberpräsident in Münster auch im Hinblick auf die Grenzen der Nbv-Bezirke im Wehrkreis VI Handlungsbedarf und forderte den Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft in Berlin am 11. September auf, „die restlichen Teile der Reg.-Bezirke Münster und Arnsberg dem Nbv Münster zuzulegen, sodaß sich deren Bezirk mit dem Wehrwirtschaftsbezirk VIa deckt“. Der Oberpräsident wies zudem darauf hin, dass der Schwerpunkt des Nbv Düsseldorf „in dem außerordentlich verkehrsreichen und verkehrsschwierigen Rheinland“ liege und die diesem unterstellten „Teile der Reg.-Bezirke Münster und Arnsberg allzu leicht ein Anhängsel bilden“.[60] Der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft, Reichswirtschaftsminister Walther Funk (1890-1960), schien diese Anregung zu unterstützen und leitete sie befürwortend an den Reichsverkehrsminister weiter.[61] Erst nach mehrmaliger Erinnerung teilte der Unterstaatssekretär und Leiter der Abteilung K (Kraftfahrwesen) im Reichsverkehrsministerium, Generalmajor Adolf von Schell (1893-1967), dem Oberpräsidenten in Münster lapidar mit, dass „z. Zt. Verhandlungen über die Neuabgrenzung der Reichsverteidigungs-Kommissare und der Kriegswirtschaftsverwaltungen“ in der Schwebe seien und es daher zweckmäßig sei, diese in Kürze zu erwartende Neuordnung abzuwarten, um nicht gezwungen zu sein, nochmals neue Abgrenzungen vorzunehmen“. Mit diesem Bescheid gab sich Oberpräsident Alfred Meyer (1891-1945) „einstweilen zufrieden“[62], zumal er bereits Anfang des Jahres aus dem Reichsministerium des Innern erfahren hatte, dass man dort ein Neuorganisation der Reichsverteidigungsbezirke in Angriff nehme und hierbei eine einheitliche Zusammenfassung der Behörden der Wirtschaftsverwaltung „unter Abgehen von den geographischen Bereichen der Wehrkreise“ anstrebe.[63] Etwa zeitgleich wurden auch im Reichsverkehrsministerium Überlegungen angestellt, die Nbv-Organisation in ihrer bisherigen Form abzuschaffen und ihre Aufgabe sowie weitere Zuständigkeiten mittelinstanzlichen Sonderbehörden, für die die Bezeichnung Straßenverkehrsdirektionen vorgesehen waren, zu übertragen.[64]
Veranlassung für einen weiteren Vorstoß des Oberpräsidenten in Münster gab mittelbar erst wieder ein Bericht des Regierungspräsidenten Arnsberg vom 12.11.1940[65], der insofern aufschlussreich ist, da der Regierungsbezirk Arnsberg auf drei Nbv-Bezirke aufgeteilt war, zu den bereits erwähnten Nbv-Bezirken Münster und Düsseldorf kam noch der Nbv im Wehrkreis IX beim Oberpräsidenten in Kassel, der für die südwestfälischen Landkreise Siegen und Wittgenstein und den Stadtkreis Siegen zuständig war. Der Regierungspräsident stellte heraus, dass die notwendigen Verhandlungen mit bis zu drei Bevollmächtigten für den Nahverkehr sehr umständlich und aufwendig seien „und ein einheitliches, gleichmäßiges Vorgehen der drei Nahverkehrsbevollmächtigten in meinem Bezirk selbst bei engster Zusammenarbeit nur schwer durchführbar“ sei. Auch sei bei den westlichen, zum Nbv-Bezirk Düsseldorf gehörenden Kreisen der Eindruck entstanden, „als ob die Zuteilung zum Nbv.-Bezirk Düsseldorf […] nicht günstig sei“, denn das Interesse dieses Nbv „gelte in erster Linie dem Rheinland, während der westfälische Teil erst an zweiter Stelle stehe“. Bei einer Zuordnung dieser Kreise an den Nbv Münster erhofften die Kreise „über den Herrn Oberpräsidenten der Provinz Westfalen eine günstigere Betreuung zu erreichen“. Auch hielt der Regierungspräsident alternativ den Gedanken, für seinen Bezirk „einen besonderen Nahverkehrsbevollmächtigten vorzusehen, [für] durchaus erwägenswert. Die Größe und die Bedeutung des Bezirks würde eine derartige Gliederung m. E. ohne weiteres rechtfertigen“. Diesen Vorschlag griff übrigens zwei Jahre später der damalige Gauleiter des Gaus Südwestfalen, Paul Giesler (1895-1945), erneut auf.[66] Anzumerken sei noch, dass Oberpräsident Dr. Meyer den Regierungspräsidenten in Arnsberg im Juni 1940 im Hinblick auf die Kreise Siegen und Wittgenstein „mit meiner Vertretung in Angelegenheiten des Reichsverteidigungskommissars für den Wehrkreis IX beauftragt“ hatte, eine Regelung, die der RVK im Wehrkreis IX, Reichsstatthalter Fritz Sauckel (1894-1946), „für durchaus zweckmäßig hielt“.[67]
Abgesehen von dem erwähnten Bericht des Regierungspräsidenten Arnsberg gab vor allem die (ergebnislose) Forderung des Gauleiters Weser-Ems und Reichsstatthalters in Oldenburg und Bremen, Karl Röver (1889-1942), nach einem eigenen Nbv für seinen Bezirk (Gau) Anlass für einen erneuten Vorstoß des Oberpräsidenten in Münster beim Reichsverkehrsminister am 2.12.1940 „auf Angleichung der Nbv-Bezirke Münster und Düsseldorf an die Grenzen der Bezirkswirtschaftsämter“.[68] Der Reichsverkehrsminister entgegnete am 27.1.1941, dass die Nbv-Bezirke weiterhin „große und geschlossene Verkehrsgebiete umfassen“ müssten, deren Neuregelung erst dann erfolgen sollte, „bis die allgemeine Lage es zuläßt, diese organisatorischen Fragen grundsätzlich zu regeln“.[69] Der Oberpräsident in Münster blieb jedoch hartnäckig und sprach sich nur wenige Tage später gegenüber dem Reichsminister des Innern dafür aus, „die gegenseitige Abgrenzung der beiden Nbv-Bezirke Münster und Düsseldorf so festzulegen, daß sie derjenigen der Wehrwirtschaftsbezirke VI a und VI b damit der Provinzgrenze“ entspreche. Im Hinblick auf die 1939 erfolgten Abgrenzung der Wehrwirtschaftsbezirke müsse es „auch möglich sein, die an sich doch wesentlich einfacheren Arbeitsgebiete der beiden Nahverkehrsbevollmächtigten abzugrenzen“.[70] Mitte 1942 griff der Oberpräsident die Angelegenheit erneut auf. Anlass gab ein Bericht des ihm angegliederten Landeswirtschaftsamtes, in dem dessen schwierige Situation bei der Zusammenarbeit mit bis zu vier für seinen Bezirk zuständigen Nbv geschildert wurde: die Nbv Düsseldorf, Münster, Kassel (für Siegen und Wittgenstein) und Hannover (für Schaumburg-Lippe).[71] Der Oberpräsident wandte sich am 12. Juni[72] an Staatssekretär Dr. Albert Ganzenmüller (1905-1996) im Reichsverkehrsministerium und gab seinen Unmut bei der in Berlin erkennbaren Einstellung zu erkennen, eine Entscheidung so lange zurückzustellen „bis die allgemeine Lage es zulasse, die organisatorischen Fragen grundsätzlich zu regeln“. Diese Auffassung sei „unter Berücksichtigung der inzwischen eingetretenen Entwicklung der Verhältnisse und in Anbetracht der vom Führer ergangenen Anordnungen über die Vereinfachung der Verwaltung jetzt wohl nicht mehr“ vertretbar. Aber auch die Reaktion Ganzenmüllers kam über einen lapidaren Hinweis auf die in dieser Sache laufenden „Verhandlungen mit den beteiligten Obersten Reichsbehörden“ nicht hinaus.[73] Beim Regierungspräsidenten Düsseldorf sah man die Angelegenheit zeitweise anders. Im Rahmen einer Nbv-Konferenz in Wiesbaden im Juli 1942 hielt der damalige Nbv Düsseldorf, Regierungsdirektor Siegel, „die Abtrennung der westfälischen Kreise von seinem Nbv-Bezirk und ihre Zuweisung an Nbv-Bezirk Münster für möglich“, stand damit aber offenbar im Widerspruch zu seinem Behördenleiter, Regierungspräsident Wilhelm Burandt (1898-1984), der „noch kürzlich“ gegenüber dem Reichsverkehrsminister „die Unmöglichkeit einer solchen Teilung“ ausgesprochen habe.[74] Oberpräsident und Gauleiter Meyer glaubte sogar, hinter der Zurückhaltung auf der Reichsebene wegen der Neuordnung der Nbv-Bezirke vor allem im Ruhrgebiet „immer wieder die alten Pläne auf Schaffung eines Ruhrgaus“ zu erkennen.[75] Jedenfalls wurden die beiden westfälischen Gauleiter Meyer und Giesler Anfang 1943 wiederholt beim Reichsverkehrsminister und Reichsminister des Innern vorstellig, um die von ihnen erwünschte Regelung keinesfalls zu gefährden. Wie bereits geschildert, erfolgte zum 1.4.1943 die Anpassung der Nbv-Bezirke an die Reichsverteidigungsbezirke, womit auch die Abgrenzung zwischen den Nbv Münster und Düsseldorf künftig den regulären Verwaltungsgrenzen entsprach. Die Übergabe der bisher zum Bezirk des Nbv Düsseldorf gehörigen Fahrbereitschaften und privaten Omnibusunternehmen erfolgte am 6.5.1943.[76]
Obwohl die Neuabgrenzung der Nbv-Bezirke von beiden Beteiligten gewünscht war, gab es schnell Meinungsverschiedenheiten zwischen den Nbv Düsseldorf und Münster über die Federführung in Verkehrsangelegenheiten des Ruhrgebiets generell, Organisationsfragen des Personenverkehrs sowie die technische Aufsicht über die Straßenbahnen. Letztere war insofern problematisch, da die Straßenbahnen im Ruhrgebiet ihre Netze in souveräner Missachtung von Verwaltungsgrenzen (aber nach dem Verkehrsbedarf) angelegt hatten, beispielsweise erstreckte sich das Netz der Vestischen Straßenbahnen von Marl bis Oberhausen in ostwestlicher und von Datteln bis Blankenstein beziehungsweise Dahlhausen in nordsüdlicher Richtung. Da wird es wenig geholfen haben, dass am 24. Juli auch die Straßenbahnangelegenheiten und die Belange des öffentlichen Personenverkehrs in den Gauen Westfalen-Nord und -Süd, soweit hierfür noch der Nbv Düsseldorf zuständig geblieben war, auf den Nbv Münster übergingen, der ab diesem Zeitpunkt „für alle Nbv-Angelegenheiten in der Provinz Westfalen und in den Ländern Lippe und Schaumburg-Lippe uneingeschränkt und ausschließlich zuständig“ war.[77] Dennoch bedurfte es für Fragen des Ruhrgebiets einer organisatorischen Lösung.
Zur Sicherstellung eines „überbezirklichen Ausgleich[s] in den Nbv-Bezirken Münster und Düsseldorf“, besonders im Verbandsgebiet des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk, errichtete der Reichsverkehrsminister am 29.7.1943 ein „Sonderreferat Ruhrgebiet“ mit Sitz in Essen.[78] Sitz des Sonderreferats war die Reichsbahndirektion Essen. Das Sonderreferat wurde Ministerialrat Enno Müller vom Reichsverkehrsministerium übertragen, der als früherer Nbv Düsseldorf mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut war.
Das Sonderreferat hatte die folgenden Aufgaben:
- Bearbeitung beziehungsweise Mitbearbeitung von Gesamtverkehrsfragen des rheinisch-westfälischen Industriegebiets sowie zusammenfassende Behandlung der dieses Gebiet betreffenden Angelegenheiten
- zwischenbezirklicher Ausgleich der Straßenverkehrsmittel und -einrichtungen in den Nbv-Bezirken Düsseldorf und Münster sowie Verfügung über die aus dem Reichsausgleich diesem Gebiet zur Verfügung gestellten materiellen und personellen Hilfsmittel
- zusammenfassende Lenkung der den Gruppenbetriebsleitungen (der Straßenbahn- oder Kraftomnibus-Betriebe) übertragenen Aufgaben.
In dieser Organisationsform der beiden Nbv Düsseldorf und Münster, für die im Hinblick auf die bezirksübergreifenden Belange des Ruhrgebiets mit dem Sonderreferat in Essen eine Koordinierungs- oder Ausgleichsstelle geschaffen wurde, scheinen die Tätigkeiten der NBV sich in der Folgezeit mehr oder weniger problemlos, jedenfalls was den Niederschlag in den Akten betrifft, entwickelt zu haben.
b) Südliche Rheinprovinz
Die südliche Rheinprovinz, also die Regierungsbezirke Koblenz und Trier gehörten ebenso wie der oldenburgische Landesteil Birkenfeld, das Saarland, die bayerische Pfalz, die linksrheinischen Gebiete des Landes Hessen zum Wehrkreis XII und dem Nbv bei dem Regierungspräsidenten in Wiesbaden. Zum Wehrkreis XII gehörten ferner die rechtsrheinischen Gebiete der hessischen Provinz Starkenburg (ohne die Kreise Offenbach, Dieburg und Erbach), der Regierungsbezirk Wiesbaden (ohne Frankfurt am Main, Wetzlar, Dillkreis, Obertaunuskreis, Kreise Biedenkopf und Usingen), aus dem Land Baden die Kreise Mannheim, Heidelberg, Mosbach und Sinsheim. An diesem Zuschnitt änderte sich zunächst nichts trotz mancher organisatorischer Änderung in den Folgejahren. Der oldenburgische Landesteil Birkenfeld wurde 1937 in die Rheinprovinz eingegliedert. Die Dienststelle des Reichskommissars für das Saarland in Saarbrücken wurde durch Verordnung vom 8.4.1940[79] „für die Dauer des Krieges“ mit der für die bayerische Pfalz zuständigen Dienststelle des Regierungspräsidenten in Speyer wurde im April 1940 für die Kriegsdauer zu einer Behörde zusammengefasst, an deren Spitze der Reichskommissar für die Saarpfalz stand. Die Behörde sollte ihren Sitz in Kaiserslautern haben, es verblieb jedoch faktisch bei dem Dienstsitz in Saarbrücken mit Außenstellen in Speyer. Dieser Dienststelle wurde im Herbst 1940 der zunächst ausschließlich für das CdZ-Gebiet Lothringen zuständige Nbv angegliedert, weil der Reichskommissar für die Saarplatz, Gauleiter Josef Bürckel, zugleich Chef der Zivilverwaltung in Lothringen geworden war. Zum 1.4.1943 änderte sich, wie bereits erwähnt, die Nbv-Organisation auch im linksrheinischen Süden grundlegend. Die Regierungsbezirke Koblenz und Trier und Luxemburg bildeten einen Nbv-Bezirk, die geschäftsführende Dienststelle war der Regierungspräsident in Koblenz. Das gesamte Land Hessen und der Regierungsbezirk Wiesbaden (ab 1944 Provinz Nassau) Nbv-Bezirk Wiesbaden (beim Regierungs- beziehungsweise 1944 Oberpräsidenten in Wiesbaden). Der Nbv in Saarbrücken wurde fortan auch für die Saarpfalz zuständig.
6. Die weitere Entwicklung der Nbv Düsseldorf und Münster nach 1945
Bereits während des Krieges gab es Überlegungen, die Nbv-Organisation nach Kriegsende beizubehalten und in der Form von Straßenverkehrsdirektionen oder dergleichen als Friedensorganisation mit erheblich erweiterten Kompetenzen, etwa im Straßenbau, aber auch in der Verkehrssicherung beizubehalten.[80] Am Beispiel der Nbv Düsseldorf und Münster soll gezeigt werden, wie unterschiedlich die tatsächliche Entwicklung verlaufen konnte, wenngleich bestimmte Elemente einer Verkehrssonderverwaltung vorübergehend eingeführt wurden.
Nach dem Einmarsch der Amerikaner amtierte der Nbv Düsseldorf zunächst weiter. Ein am 19.5.1945 vom XXII. Corps der US Army vorgelegter „Ziviler Transportplan“[81] bestimmte unter anderem: „Die bisherige deutsche Organisation wird in vollem Umfang übernommen. Der Nbv ist verantwortlich für die Tätigkeit, Kontrolle, Zulassung und Anweisung der Ladungen. Der Nbv ist seinerseits wieder der Militär-Regierung verantwortlich. Das Recht der Überprüfung der deutschen Berichte und Fahrzeuge wie auch unzweckmäßiger Arbeiten verbleibt unbedingt der Militärregierung.“[82] So informierte der seit 1943 amtierende Nbv Düsseldorf, Oberregierungsrat Dr. Karl Schmitt, am 26. Mai in einer Rundverfügung[83] die Behörden seines Bezirks, dass die Militärregierung ihm Vollmacht erteilt habe, „mit ihrem Einvernehmen sämtliche Maßnahmen zur Regelung des Straßenverkehrs in den Regierungsbezirken Düsseldorf, Köln und Aachen zu ergreifen“, und ordnete an, dass die Arbeitsgebiete der Zulassungsstellen, der Fahrbereitschaften und der Treibstoffversorgung zweckmäßigerweise in der Hand der Fahrbereitschaftsleiter zusammenzulegen seien. Ohne erkennbaren Grund wurde Nbv Dr. Schmitt seines Amtes enthoben.[84] Zu seinem Nachfolger bestimmte die amerikanische Militärregierung Oberregierungsrat Dr. Karl Vormann.[85] Dieser wurde „zum aktiven Leiter des Nahverkehrs“ in den drei nordrheinischen Regierungsbezirken ernannt, ferner verpflichtet, „zu einem gerechten und wirksamen Programm beizutragen“. Er wurde „verantwortlich für alle Handlungen, Erlasse und Neuerungen auf dem Gebiete des deutschen zivilen Straßentransports einschl. aller Straßenbahnen und Fuhrunternehmen, die für alliierte militärische und vordringliche Zwecke benötigt werden“, auch „für alle Erleichterungen des Straßentransports“. Zudem hatte er „die Lager mit Treibstoff, Schmieröl, Autoreifen und Ersatzteilen“ zu kontrollieren und „für eine gerechte Rationierung des Treibstoffs Sorge zu tragen“.
Kurz darauf unterrichtete der Regierungspräsident die Landräte und Oberbürgermeister als Kreispolizeibehörden und die Polizeipräsidenten seines Bezirks darüber, dass nach einer Anordnung des XXII. Corps „bis zu einer endgültigen Regelung durch die Alliierte Kontroll-Kommission die Zulassung von deutschen Kraftfahrzeugen durch den Bevollmächtigten für den Nahverkehr erfolgt“.[86] Als Folge unterstanden die Kraftfahrzeugzulassungsstellen dem Nbv und schieden aus der Polizeiverwaltung aus. Die örtlichen Fahrbereitschaftsleiter wurden zu Leitern der Zulassungsstellen bestellt und firmierten fortan als „Der Landrat/Oberbürgermeister – Fahrbereitschaftsleiter – Kraftfahrzeugzulassungsstelle“. Die übrigen Bestimmungen zur Nbv-Organisation sollten in Kraft bleiben, sofern sie nicht vom Nbv aufgehoben, geändert oder ergänzt wurden.
Am 21.6.1945 ging die Militärregierung auf die Briten über. Den Briten schien die Nbv-Organisation bekannt zu sein, denn kurz danach informierte ein britischer Transportoffizier, Major Dow, darüber, der Nbv sei „eine amtliche Organisation, die auf Befehl der 21. Armeegruppe wieder eingesetzt worden ist. Die Organisation hat alle Fahrbereitschaften zu kontrollieren.“[87] Im Zuge des Aufbaus einer deutschen zivilen Verwaltung wurde für den nördlichen Teil der Rheinprovinz, der nunmehr zur britischen Zone gehörte, als oberste deutsche Behörde ein Oberpräsident für die Nord-Rheinprovinz eigesetzt mit Sitz zunächst in Bonn, ab 28. Juni in Düsseldorf.[88] Zum Oberpräsidenten wurde Dr. Hans Fuchs ernannt, der bereits von 1922 bis 1933 das Amt des Oberpräsidenten der Rheinprovinz inne gehabt hatte. Eine der ersten Amtshandlungen des Oberpräsidenten war die Eingliederung des Nbv Düsseldorf in seine Abteilung Verkehr, zugleich wurde Dr. Vormann „zum Leiter des Nahverkehrs in den Regierungsbezirken Düsseldorf, Köln und Aachen“ ernannt beziehungsweise im Amt bestätigt.[89] Noch am selben Tage unterrichtete Dr. Vormann – unter dem Briefkopf „Der Oberpräsident der Nord-Rheinprovinz – Abt. Verkehr – Bevollmächtigter für den Nahverkehr“ – hierüber seinen bisherigen Dienstvorgesetzten, den Regierungspräsidenten in Düsseldorf, Eduard Sträter (1884-1958), und teilte zugleich, schon im Tone einer vorgesetzten Behörde (was ja durchaus zutraf) mit, hiermit sei „die bisherige Angliederung der Dienststelle an den Herrn Regierungspräsidenten hinfällig geworden und die unmittelbare Stellung unter den Herrn Oberpräsidenten“ vollzogen.[90] Nach einigen eher atmosphärischen Störungen zwischen Regierungs- und Oberpräsident erfolgte die Übergabe der Geschäfte dann reibungslos, so dass der Nbv Düsseldorf den nachgeordneten Behörden seine Bestellung als Dienststelle des neuen Oberpräsidenten anzeigen konnte.[91] Die Fahrbereitschaftsleiter behielten bis auf weiteres ihre Aufgaben und Zuständigkeiten entsprechend der Dienstanweisung für Fahrbereitschaftsleiter vom 10.6.1942.[92] Die Fortgeltung dieser Dienstanweisung bestätigte der Nbv Düsseldorf indirekt in einem Schreiben an den Oberpräsidenten der Provinz Westfalen – Straßenverkehrsdirektion – vom 14.1.1946[93] und führte ergänzend aus, dass für fachliche Weisungen künftig ausschließlich der Nbv zuständig sei, während die Landräte und Oberbürgermeister die Fahrbereitschaftsleiter nur noch zu beaufsichtigen hatten, „dahingehend, daß sie die Durchführung meiner sachlichen Weisungen durch die Fahrbereitschaftsleiter“ überwachen. Die Militärregierung erkannte im Übrigen im Straßenverkehr Zuständigkeiten der Landräte und Oberbürgermeister nicht mehr an, sie betrachtete den Nbv mit seinen Fahrbereitschaftsleitern als eine „selbständige Straßenverkehrsorganisation“. Daher sei auch beabsichtigt, „eine Loslösung der Fahrbereitschaftsleiter von den Landräten/Oberbürgermeistern vorzunehmen“.
Zu Beginn des Jahres 1946 wurde durch die britische Militärregierung als zonale Fachbehörde die Straßenbau- und Verkehrsgeneraldirektion in der britischen Zone mit Sitz in Bielefeld errichtet. Sie übernahm Aufgaben des früheren Reichsverkehrsministeriums, Abteilung Kraftverkehr und Straßen, und des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen. Ihre vorgesetzte britische Dienststelle war Highways Branch der Transport Division der Control Commission for Germany (British Element) in Hamburg. Ihr Geschäftsbereich umfasste unter anderem die Straßenverkehrsdirektionen mit den nachgeordneten Stellen: Straßenverkehrshauptämter, Straßenverkehrsämter und Straßenbauämter.[94] Entsprechend dieser zonalen Vorgaben wurde zum 1.4.1946 auch in der Nord-Rheinprovinz die bisherige Nbv-Organisation umgewandelt. Oberste Straßenverkehrsbehörde in der Nord-Rheinprovinz wurde die Straßenbau- und Verkehrsdirektion Düsseldorf. In ihr wurden die Aufgaben des bisherigen Nbv (Straßenverkehr) und der Straßenverwaltung des Provinzialverbandes (Straßenbau) zusammengefasst. Die bisher noch bestehenden Gruppenfahrbereitschaftsleiter wurden zu fünf Straßenverkehrs-Hauptämtern in Aachen, Düsseldorf, Köln, Krefeld und Mülheim an der Ruhr zusammengefasst. Die bisherigen Fahrbereitschaften und Zulassungsstellen in den Kreisen wurden zu besonderen Straßenverkehrsämtern und waren aus den Stadt- und Landkreisen ausgegliedert.[95]
Anders (und einfacher) verlief die Entwicklung der bisherigen Nbv-Organisation in der Provinz Westfalen. Dort wurde bereits am 29.5.1945 durch Erlass des Oberpräsidenten eine Straßenverkehrsdirektion (für die Provinz Westfalen, das Land Lippe und bis 1946 auch Schaumburg-Lippe) mit nachgeordneten kommunalen Straßenverkehrsämtern in fast allen Stadt- und Landkreisen eingerichtet: nur in Herford, Iserlohn, Recklinghausen und Siegen gab es gemeinsame Straßenverkehrsämter für Stadt- und Landkreis. Die Straßenverkehrsdirektion gliederte sich in zwei Abteilungen: Abteilung Straßenverkehr des bisherigen Nbv Münster und Abteilung Straßenbau, zuvor bei der Verwaltung des nicht weiter bestehenden westfälischen Provinzialverbands. In Anpassung an die zonalen Vorgaben (und im Hinblick auf die bevorstehende Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen) wurden zum 1.8.1946 noch fünf Straßenverkehrs-Hauptämter in Münster, Dortmund, Arnsberg, Minden und Detmold errichtet, am 1.3.1947 kamen noch Recklinghausen und Lüdenscheid hinzu.[96]
Nach der Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen im August 1946 wurden auf Anordnung der Militärregierung durch Erlass des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen vom 5.10.1946 die beiden provinzialen Straßenbau- und Verkehrsdirektionen in Düsseldorf und Münster zur neuen Straßenbau- und Verkehrsdirektionen in Düsseldorf zusammengelegt. Ihr unterstanden zwölf Straßenverkehrs-Hauptämter in Aachen, Arnsberg, Detmold, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Krefeld, Lüdenscheid, Minden, Mülheim an der Ruhr, Münster und Recklinghausen sowie rund 90 Straßenverkehrsämter in jedem Stadt- und Landkreis, wobei die Straßenverkehrsämter in Westfalen und Lippe im Verband der Stadt- und Kreisverwaltungen verblieben. Im Jahre 1948 wurde die Straßenverkehrssonderverwaltung wieder aufgehoben, die Straßenverkehrsämter im nordrheinischen Landesteil wieder in die Stadt- und Kreisverwaltungen eingegliedert, die Straßenverkehrs-Hauptämter und die Straßenbau- und Verkehrsdirektion aufgelöst, ihre Aufgaben soweit erforderlich auf die Regierungspräsidenten beziehungsweise die Straßenverkehrsämter sowie das Verkehrsministerium übertragen.[97]
Im Rahmen der Auflösung der Straßensonderverwaltung in Nordrhein-Westfalen erscheint noch einmal der Bevollmächtigte für den Nahverkehr: Im Zuge der Übertragungen von Aufgaben auf die Regierungspräsidenten übertrug der Verkehrsminister durch Runderlass vom 30.10.1948[98] diesen auch die Aufgaben und Befugnisse „der Bevollmächtigten für den Nahverkehr im Sinne der Verordnung zur Einschränkung des Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen vom 6.12.1939 in Verbindung mit den Ausführungsbestimmungen vom 16.12.1939, und zwar mit der Maßgabe, daß die Genehmigungsbefugnis für einzelne Fernbeförderungen bis auf weiteres den Straßenverkehrsämtern als Auftragsangelegenheit überlassen bleibt.“ Aber auch die Verordnung von 1939 wurde 1949 aufgehoben.
Quellen
Ungedruckte Quellen
Bundesarchiv: Bestände R 2: Reichsfinanzministerium und R 5: Reichsverkehrsministerium
Deutsche Bahn AG, Zentrales Personalaktenarchiv, Berlin
Hauptstaatsarchiv Stuttgart (HSTA Stuttgart): Bestand E 151/01 - Innenministerium Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (LAV NRW), Abt. Rheinland (LAV NRW R): Bestand BR 1021 – Regierung Düsseldorf, Verfassung und Verwaltung; Bestand NW 84 – Verkehrsministerium; Abt. Westfalen (LAV NRW W): Bestand Oberpräsidium OP
Österreichische Staatsarchiv (ÖSTA), Archiv der Republik (ADR): Bürckel-Materien
Thüringisches Hauptstaatsarchiv (ThürHSTA), Bestände MdI A 63, RStH
Gedruckte Quellen
Amtliche Mitteilungen für die Stadtverwaltung Krefeld 1946
Krefelder Amtsblatt 1941
Krefelder Haushaltsplan 1941
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen (Ministerialblatt NW) Reichsgesetzblatt (RGBl.) Teil I 1931-1943
Reichsverkehrsblatt Teil B: Kraftfahrwesen 1939-1945
Verordnungsblatt des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß 1940-1942 Verordnungsblatt für Lothringen 1940-1942
Literatur
Kursiv = Kurzzitierweise
Absolon, Rudolf, Die Wehrmacht im Dritten Reich, Bände 1, 3-5, Boppard 1969-1988.
Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, hg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Band 5: Organisation und Mobilisierung des deutschen Machtbereichs, 1. Halbband: Kriegsverwaltung, Wirtschaft und personelle Ressourcen 1939-1941, Stuttgart 1988.
Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band 4: Das Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus, Stuttgart 1985.
Dorfey, Beate, Die Teilung der Rheinprovinz und die Versuche zu ihrer Wiedervereinigung (1945–1956). Das Rheinland zwischen Tradition und Neuordnung, Köln/Bonn 1993.
Fleischhauer, Markus, Der NS-Gau Thüringen 1939-1945. Eine Struktur und Funktionsgeschichte, Köln [u.a.] 2010.
Gabrielsson, Peter, Bürgermeister, Senatoren und Staatsräte der Freien und Hansestadt Hamburg 1945–1995. Zuständigkeiten und Behörden, Hamburg 1995.
Hölscher, Wolfgang (Bearb.), Nordrhein-Westfalen. Deutsche Quellen zur Entstehung des Landes 1945/46, Düsseldorf 1988.
Kettenacker, Lothar, Die Chefs der Zivilverwaltung im Zweiten Weltkrieg, in: Rebentisch, Dieter/Teppe, Karl (Hg.), Verwaltung contra Menschenführung im Staat Hitlers. Studien zum politisch-administrativen System, Göttingen 1987, S. 386–417.
Kittel, Theodor/Wehrmann, Wolfgang, Das Reichsverkehrsministerium, Berlin 1940.
Leesch, Wolfgang, Die Verwaltung der Provinz Westfalen 1815–1945. Struktur und Organisation, 2. Auflage, Münster 1993.
Lilla, Joachim, Die Bevollmächtigten für den Nahverkehr (Nbv) und ihre nachgeordneten Dienststellen in Österreich 1938 bis 1945, in: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 46 (1998), S. 147–188.
Petzina, Dieter, Autarkiepolitik im Dritten Reich. Der nationalsozialistische Vierjahresplan, Stuttgart 1968.
Preußisches Staatshandbuch für das Jahr 1939, 141. Jahrgang, hg. vom Preußischen Staatsministerium, Berlin [1939].
Priamus, Heinz-Jürgen, Meyer. Zwischen Kaisertreue und NS-Täterschaft. Biographische Konturen eines deutschen Bürgers, Essen 2011.
Romeyk, Horst, Kleine Verwaltungsgeschichte Nordrhein-Westfalens, Siegburg 1988.
Romeyk, Horst, Verwaltungs- und Behördengeschichte der Rheinprovinz 1914–1945, Düsseldorf 1985.
Vogel, Walter, Westdeutschland 1945–1950. Der Aufbau von Verfassungs- und Verwaltungseinrichtungen über den Ländern der drei westlichen Besatzungszonen. Teil 3: Einzelne Verwaltungszweige: Finanzen; Post und Verkehr; Arbeit und Soziales; Flüchtlinge; Suchdienst und Kriegsgefangene; Justiz; Inneres, Boppard 1983.
Online
Lilla, Joachim, Die Organisation der kriegswirtschaftlichen Sonderverwaltungen und der Reichsverteidigung im Rheinland (1936/1939 bis 1945), in: Portal Rheinische Geschichte. [Online]
Lilla, Joachim, Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945. [Online]

Karte der Wehrkreise im Jahr 1939 nach der Annexion Österreichs. (Gemeinfrei)
- 1: RGBl. 1931 I, S. 537. Vgl. auch Deutsche Verwaltungsgeschichte 4, S. 269-270.
- 2: RGBl. 1935 I, S. 788. Zur Vorgeschichte des Gesetzes und seiner verkehrspolitischen Zielsetzung vgl. Deutsche Verwaltungsgeschichte 4, S. 916-917.
- 3: RGBl. 1936 I, S. 320.
- 4: RdErl des Reichsverkehrsministers vom 27.8.1937 (Reichsverkehrsblatt B, S. 185). Diese Regelung gab es anscheinend schon seit Anfang 1937, wie einer Pressemeldung (Rheinische Landeszeitung Krefeld Nr. 15, 15.1.1937) zu entnehmen ist.
- 5: Reichsverkehrsminister (RVM) an Reichsfinanzminister (RFM), 17.5.1941 (BArch R 2/23033, fol. 96).
- 6: Privatdienstschreiben von Staatssekretär Gustav Koenigs, RVM, an Minister a.D. Eduard Hamm, 24.1.1938 (BArch R 5/8670).
- 7: Kurze Hinweise finden sich etwa bei Romeyk, Rheinprovinz, S. 139, 141, 145-146, bei Leesch, Provinz Westfalen, S. 25, 27; bei Fleischhauer, NS-Gau Thüringen, S. 145-148. u.a., weitere Informationen: Lilla, Nbv Österreich, passim.
- 8: So der RVM rückblickend 1941 (BArch R 2/23033, fol. 98).
- 9: Dieser Erlass, Aktenzeichen RL/K 3 Nr. 1265/36 gRs., ließ sich bislang nicht ermitteln. Er wird erwähnt in Anlage 1 zum RdErl des Reichsverkehrsministers vom 27.1.1940, RL/K 9.127/40 (BArch R 2/23032, fol. 160-165). Dort werden grundsätzliche Ausführungen zu Organisation und Aufgaben der Nbv gemacht, die im Folgenden skizziert werden.
- 10: Vermerk RFM, 2.7.1941 (BArch R 2/23033, fol. 125).
- 11: Vermerk des württembergischen Innenministers, Az. I 1438, 30.11.1944 (HSTA Stuttgart E 151/01 Bü 299, fol. 9).
- 12: Oberpräsident Hannover an RVM, 15.9.1936 (BArch R 5/8029).
- 13: RdErl des RVM vom 3.4.1940 (ThürHSTA MdI A 63).
- 14: Kittel/Wehrmann, Reichsverkehrsministerium, S. 48.
- 15: Zur Entwicklung der Wehrkreise vgl. Absolon, Wehrmacht I, S. 242-243; III, S.39-40, 149; IV, S. 171; V, S. 387. Zu Einzelheiten der Einteilung der Wehrkreise siehe die Verordnungen für die Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich vom 1.10.1936 (RGBl. 1936 I, S. 811), vom 24.3.1937 (RGBl. 1937 I, S. 381), vom 5.10.1937 (RGBl. 1937 I, S. 1057), vom 15.9.1939 (RGBl. 1939 I, S. 1777), vom 17.7.1941 (RGBl. 1941 I, S. 391).
- 16: n der Folgezeit gab es mehrere Änderungen in der Einteilung der Wehrkreise, die sich teilweise auf den Bestand der Nbv-Organisation auswirkte. Im Oktober 1937 wurden die Wehrersatzbezirke aus dem Wehrkreis VII (München) ausgegliedert und mit einigen Gebieten aus dem Wehrkreis V (Stuttgart) zu einem neuen Wehrkreis XIII mit Sitz in Nürnberg zusammengefasst. Der neu errichtete Nbv firmierte zunächst als Außenstelle des Staatsministers des Innern in Nürnberg-Fürth. Mit dem Anschluss Österreichs wurden in den zum 1.4.1938 neu errichteten Wehrkreisen XVII (Sitz Wien) und XVIII (Sitz Salzburg) Nbv errichtet für den Wehrkreis XVII zunächst beim Reichsstatthalter in Österreich – Landesregierung – und für den Wehrkreis XVIII zunächst beim Landeshauptmann in Salzburg (ab 1940 bei den Reichsstatthaltern in Wien beziehungsweise Salzburg). Die im Herbst 1938 annektierten sudetendeutschen Gebiete wurden in die Wehrkreise VIII (Breslau), IV (Dresden) und XIII (Nürnberg) eingegliedert. Erst im Juni 1944 wurde beim Reichstatthalter in Reichenberg ein eigener Nbv für den Reichsgau Sudetenland errichtet. In den im Oktober 1939 angegliederten Gebieten Danzig-Westpreußen und Wartheland wurden die Wehrkreise XX (Danzig) und XXI (Posen) errichtet, deren Nbv jeweils den Reichsstatthaltern in Danzig und Posen beigegeben wurden. Im Rahmen der Organisation der Wehrwirtschaftsverwaltung waren einige Wehrkreise in zwei Wehrwirtschaftsbezirke aufgeteilt.
- 17: n der Folgezeit gab es mehrere Änderungen in der Einteilung der Wehrkreise, die sich teilweise auf den Bestand der Nbv-Organisation auswirkte. Im Oktober 1937 wurden die Wehrersatzbezirke aus dem Wehrkreis VII (München) ausgegliedert und mit einigen Gebieten aus dem Wehrkreis V (Stuttgart) zu einem neuen Wehrkreis XIII mit Sitz in Nürnberg zusammengefasst. Der neu errichtete Nbv firmierte zunächst als Außenstelle des Staatsministers des Innern in Nürnberg-Fürth. Mit dem Anschluss Österreichs wurden in den zum 1.4.1938 neu errichteten Wehrkreisen XVII (Sitz Wien) und XVIII (Sitz Salzburg) Nbv errichtet für den Wehrkreis XVII zunächst beim Reichsstatthalter in Österreich – Landesregierung – und für den Wehrkreis XVIII zunächst beim Landeshauptmann in Salzburg (ab 1940 bei den Reichsstatthaltern in Wien beziehungsweise Salzburg). Die im Herbst 1938 annektierten sudetendeutschen Gebiete wurden in die Wehrkreise VIII (Breslau), IV (Dresden) und XIII (Nürnberg) eingegliedert. Erst im Juni 1944 wurde beim Reichstatthalter in Reichenberg ein eigener Nbv für den Reichsgau Sudetenland errichtet. In den im Oktober 1939 angegliederten Gebieten Danzig-Westpreußen und Wartheland wurden die Wehrkreise XX (Danzig) und XXI (Posen) errichtet, deren Nbv jeweils den Reichsstatthaltern in Danzig und Posen beigegeben wurden. Im Rahmen der Organisation der Wehrwirtschaftsverwaltung waren einige Wehrkreise in zwei Wehrwirtschaftsbezirke aufgeteilt.
- 18: RdErl des RVM vom 27.1.1940 (BArch R 2/23032, fol. 2).
- 19: RVM, Kriegsgeschäftsverteilungsplan für die Abteilungen K, S, W, Januar 1940 (BArch R 5/9330, fol. 13-15.
- 20: Preußisches Staatshandbuch 1939, S. 150-151, waren drei der zwölf Referenten und zwei der acht Amtsräte der Abteilung K zugleich für die Gruppe LV tätig.
- 21: RVM, Geschäftsverteilungsplan Abt. K, Juli 1940 (BArch R 5/9330, fol. 22ff.).
- 22: RVM, Geschäftsverteilungsplan August 1944 (BArch R 5 9330, fol. 124ff.).
- 23: Zuletzt Generalleutnant.
- 24: Absolon, Wehrmacht IV, S. 375; Petzina, Autarkiepolitik, S. 121. Rheinische Landeszeitung Krefeld Nr. 32, 22.11.1938 (mit Foto). Schell war seinerzeit Chef des Stabes der Panzertruppen und Heeresmotorisierung.
- 25: Kittel/Wehrmann, Reichsverkehrsministerium, S. 51.
- 26: Generalfeldmarschall Göring an RVM, 6.4.1940 (ThürHSTA RSTH 271, fol. 89).
- 27: RdErl des RVM vom 4.10.1939, K 9.10. 583/39 (BArch R 5/8029).
- 28: LAV NRW R BR 1021/276, fol. 4. Die Ziffern der Arbeitsgebiete des Mustergeschäftsverteilungsplanes sind in eckigen Klammern ergänzt worden. – Die Umsetzung dieser Vorgaben erfolgte nicht einheitlich. Der Nbv Hannover hatte fünf Dezernate (BArch R 5/9311, fol..410ff.), der Nbv Weimar nur zwei Referate (BArch R 5/8672).
- 29: RdErl des RVM vom 30.7.1941, allerdings ohne Überlieferung der Geschäftsverteilung. Diese ließ sich jedoch aus neuen Geschäftsverteilungplänen des Nbv Stuttgart vom 1.10.1941 (HSTA Stuttgart E 151/01 Bü 299, fol. 1ff), des Nbv Düsseldorf vom Herbst 1941 (LAV NRW R BR 1021/351) sowie des Nbv Berlin um Mitte 1942 (BArch R 2/23831, fol. 84-86) erschließen.
- 30: LAV NRW R BR 1021/351.
- 31: Verfügung des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld, 13.2.1941 (Krefelder Amtsblatt 1941, S. 64). Im Haushaltsplan 1941 wurde die Haushaltsstelle „Sächliche Kosten der Fahrbereitschaft“ neu eingestellt (Krefelder Haushaltsplan 1941, S. 26). Die Stelle bestand unter dem ehrenamtlichen Fahrbereitschaftsleiter aus maximal vier hauptamtlichen Bediensteten. Sie firmierte unter einem besonderen Briefkopf „Der Oberbürgermeister – Fahrbereitschaftsleiter“.
- 32: RdErl. RVM, 1.10.1939 (ÖSTA-AdR, Bürckel-Materien 2640). – Die Verfügung des Oberbürgermeisters von Krefeld vom 13.2.1941 (Krefelder Amtsblatt 1941, S. 64) spricht von „während des Krieges eingerichteten Fahrbereitschaften“.
- 33: Reichsverkehrsblatt 1942 B, S. 80.
- 34: Durchführungsanordnung des RVW zur Verordnung über die Reichsverteidigungskommissare und Vereinheitlichung der Wirtschaftsverwaltung vom 16.11.1942 vom 11.5.1944 (Reichs-Verkehrs-Blatt 1942 B, S. 75).
- 35: Bezirksfahrbereitschaftsleiter, RdErl des RVM vom 1.6.1944 (Reichs-Verkehrs-Blatt 1942 B, S. 85).
- 36: Dieser Abschnitt fasst die Ergebnisse aus zahlreichen Personalakten, Personalverzeichnissen, Sachakten zusammen, so dass auf Einzelnachweise verzichtet wird.
- 37: Lilla, Joachim, Deischl, Erwin, in: Lilla, Joachim, Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-)Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945, URL: https://verwaltungshandbuch.bayerische-landesbibliothek-online.de/deischl-erwin (26.11.2014 ).
- 38: Lilla, Joachim, Wetzler, Walter, in: Lilla, Joachim, Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-)Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945, URL: <https://verwaltungshandbuch.bayerische-landesbibliothek-online.de/wetzler-walter> (22.7.2013 ).
- 39: Gabrielsson, Bürgermeister, S. 164.
- 40: Liegel, Otto, in: Lilla, Joachim, Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-)Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945, URL: https://verwaltungshandbuch.bayerische-landesbibliothek-online.de/liegel-otto. (11.10.2012 ).
- 41: Parigger, Karl, in: Lilla, Joachim, Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-)Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945, URL: <https://verwaltungshandbuch.bayerische-landesbibliothek-online.de/parigger-karl> (9.8.2016).
- 42: Zu den CdZ im Operationsgebiet vgl. Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 5/1, S. 55-56. Deren Tätigkeit ist bislang kaum erforscht. Eine lobenswerte Ausnahme ist die vorzügliche Darstellung der Tätigkeit des westfälischen Oberpräsidenten Dr. Alfred Meyer als Chef der Zivilverwaltung beim Armeeoberkommando 5, der Armeeabteilung Nord und im Wehrkreis VI von Priamus, Meyer, S. 312–324.
- 43: Vgl. Romeyk, Rheinprovinz, S. 132.
- 44: Kettenacker, Chefs der Zivilverwaltung, S. 386-388.
- 45: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 5/1, S. 137, Anm. 7.
- 46: Vgl. für Einzelheiten die Verordnungsblätter für das Elsass, für Lothringen und für Luxemburg 1940 und 1941.
- 47: Deutsche Verwaltungsgeschichte 4, S. 1160.
- 48: Einzelnachweise vgl. Lilla, Nbv Österreich.
- 49: Deutsche Verwaltungsgeschichte 4, S. 1163-1164.
- 50: Reichs-Verkehrs-Blatt 1944 B, S. 99.
- 51: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 5/1, S. 62-63; Reichs-Verkehrs-Blatt 1943 B, S. 29.
- 52: Vgl. Reichs-Verkehrs-Blatt 1943 B, S. 96.
- 53: RGBl. 1942 I, S. 649.
- 54: Durchführungsanordnung zur Verordnung über die Reichsverteidigungskommissare und die Vereinheitlichung der Wirtschaftsverwaltung vom 16. November 1942 vom 30. März 1943 (Reichs-Verkehrs-Blatt 1943 B, S. 35.
- 55: Mit der Bezeichnung: Minister des Innern – Bevollmächtigter für den Nahverkehr – zugleich für den Chef der Zivilverwaltumg im Elsass.
- 56: Mit der Bezeichnung: Regierungspräsident – Bevollmächtigter für den Nahverkehr – zugleich für den Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg.
- 57: Reichs-Verkehrs-Blatt 1944 B, S. 95.
- 58: Reichs-Verkehrs-Blatt 1945 B, S. 17.
- 59: nlass für diese recht ungewöhnliche, die Grenzen der höheren Verwaltungsbezirke missachtende Abgrenzung der Nbv-Bezirke Düsseldorf und Münster war vermutlich die Absicht, „das Ruhrgebiet in verkehrstechnischer Hinsicht nicht zerschneiden zu wollen“.
- 60: nlass für diese recht ungewöhnliche, die Grenzen der höheren Verwaltungsbezirke missachtende Abgrenzung der Nbv-Bezirke Düsseldorf und Münster war vermutlich die Absicht, „das Ruhrgebiet in verkehrstechnischer Hinsicht nicht zerschneiden zu wollen“.
- 61: LAV NRW W OP 7106, fol. 3-4.
- 62: UStS im RVM an OP Westfalen, 24.4.1940 (LAV NRW W OP 7106, fol. 11).
- 63: Rebentisch, S. 142.
- 64: RMdI an RVM, 3.1.1941, Personalakte Deischl (DB-ZPa); weitere Hinweise in BArch R 2/23033, vgl. auch Romeyk, Rheinprovinz, S. 146.
- 65: LAV NRW W OP 7106, fol. 13.
- 66: Gauleiter Giesler an StS Dr. Albert Ganzenmüller, RVM. 31.12.1944 (LAV NRW W OP 7106, fol. 57).
- 67: Vorgänge in ThürHSTA RStH 468.
- 68: LAV NRW W OP 7106, fol. 14.
- 69: LAV NRW W OP 7106, fol. 16.
- 70: Oberpräsident an Staatssekretär Dr. Stuckart, RMdI (LAV NRW W OP 7106, fol. 18-21).
- 71: Oberpräsident – Landeswirtschaftsamt – an Oberpräsident, 8.5.1942 (LAV NRW W OP 7106, fol. 23f.).
- 72: LAV NRW W OP 7106, fol. 29ff.
- 73: StS Dr. Ganzenmüller, RVM, an Gauleiter und Reichsstatthalter [!] der Provinz Westfalen, 7.7.1942 (LAV NRW W OP 7106, fol. 42).
- 74: Nbv Münster an Oberpräsident (LAV NRW W OP 7106, fol. 45f.).
- 75: Gauleiter Dr. Meyer an Gauleiter Paul Giesler, Westfalen-Süd, 24.12.1942 (LAV NRW W OP 7106, fol. 53f.).
- 76: Rundschreiben 72/26 des Nbv Düsseldorf, 10.5.1943 (LAV NRW W OP 7106, fol. 81).
- 77: Rundschreiben 119/35 des Nbv Düsseldorf, 6.9.1943 (LAV NRW W OP 7106, fol. 86).
- 78: RdErl des RVM vom 29.7.1943 (Reichs-Verkehrs-Blatt 1843 B, S. 109).
- 79: RGBl. 1940 I.
- 80: Vermerk RVM, 2.7.1941 (BArch R 2/23033,fol. 125). Ferner Kittel/Wehrmann, Reichsverkehrsministerium, S. 40, Romeyk, Rheinprovinz, S. 146. Zum Folgenden auch Romeyk, Nordrhein-Westfalen, S. 277-279.
- 81: ach dem Einmarsch der Amerikaner amtierte der Nbv Düsseldorf zunächst weiter. Ein am 19.5.1945 vom XXII. Corps der US Army vorgelegter „Ziviler Transportplan“
- 82: LAV NRW R NW 84/105, Abschnitt III, Nr. 8.
- 83: ach dem Einmarsch der Amerikaner amtierte der Nbv Düsseldorf zunächst weiter. Ein am 19.5.1945 vom XXII. Corps der US Army vorgelegter „Ziviler Transportplan“
- 84: Vgl. Regierungspräsident Düsseldorf an ORR Dr. Karl Schmitt, 20.7.1945 (LAV NRW R BR 1021/351).
- 85: HQ XXII Corps Apo 250 US Army an Dr. Karl Vormann, 5.6.1945 (LAV NRW R NW 84/105, fol. 7).
- 86: Verfügung des Regierungspräsidenten Düsseldorf vom 9.6.1945 (LAV NRW R NW 84/119, fol. 10).
- 87: Major Dow, Det. 318/319 MilGov (RdTpt) an Det. 612 MilGov, 12.7.1945 (LAV NRW R NW 84/119, fol. 35).
- 88: Vgl. unter anderem Hölscher, Nordrhein-Westfalen, S. 18-19, 137-138 (Dokumente 9 und 10); Dorfey, Teilung, S. 113ff.
- 89: m 21.6.1945 ging die Militärregierung auf die Briten über. Den Briten schien die Nbv-Organisation bekannt zu sein, denn kurz danach informierte ein britischer Transportoffizier, Major Dow, darüber, der Nbv sei „eine amtliche Organisation, die auf Befehl der 21. Armeegruppe wieder eingesetzt worden ist. Die Organisation hat alle Fahrbereitschaften zu kontrollieren.“
- 90: m 21.6.1945 ging die Militärregierung auf die Briten über. Den Briten schien die Nbv-Organisation bekannt zu sein, denn kurz danach informierte ein britischer Transportoffizier, Major Dow, darüber, der Nbv sei „eine amtliche Organisation, die auf Befehl der 21. Armeegruppe wieder eingesetzt worden ist. Die Organisation hat alle Fahrbereitschaften zu kontrollieren.“
- 91: Oberpräsident der Nord-Rheinprovinz – Nbv – Rundschreiben Nr. 1 an Landräte/Oberbürgermeister, Gruppenfahrbereitschaftsleiter, Sondervertrauensmänner des privaten Omnibusgewerbes und die Straßenbahnunternehmen, 4.7.1945 (LAV NRW R NW 84/118, fol. 7).
- 92: Reichs-Verkehrs-Blatt 1942 B, S. 80.
- 93: LAV NRW R NW 84/118, fol. 19.
- 94: Vogel, Westdeutschland, S. 281-285.
- 95: Erlass des Oberpräsidenten der Nord-Rheinprovinz, VöA/840-850 (veröffentlicht u.a. in Amtliche Mitteilungen der Stadtverwaltung Krefeld 1946, S. 87. Vgl. auch Romeyk, Nordrhein-Westfalen, S. 277-280.
- 96: Leesch, Provinz Westfalen, S. 25 mit Anm. 30.
- 97: Romeyk, Nordrhein-Westfalen, S. 278-279.
- 98: Ministerialblatt NW 1948, S. 597.
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.
Lilla, Joachim, Die Bevollmächtigten für den Nahverkehr (Nbv) im „Dritten Reich“ unter besonderer Berücksichtigung der Rheinlande, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-bevollmaechtigten-fuer-den-nahverkehr-nbv-im-dritten-reich-unter-besonderer-beruecksichtigung-der-rheinlande/DE-2086/lido/605dbae6c1bc30.08113731 (abgerufen am 07.05.2024)