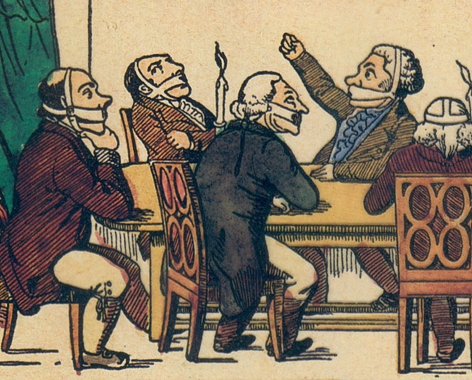Zu den Kapiteln
Schlagworte
1. Prolog
Niemand konnte im Jahre 1935 ahnen, dass das Erstlingswerk eines Bonner Doktoranden über die Sagenwelt seiner Eifelheimat zu einem Bestseller werden sollte. Die Materialsammlung zu seiner Dissertation erschien 1935 unter dem Titel „Volkssagen der Westeifel“ mit einem Umfang von 272 Druckseiten. 1966 kam, jetzt unter dem Titel „Sagen und Geschichten aus der Westeifel“, eine mit 656 Druckseiten doppelt so umfangreiche Neuauflage auf den Markt. Sie verkaufte sich gut, denn 1980 und 1986 erschienen zwei weitere Ausgaben, die seit Jahren vergriffen sind. 2013 erschien unter dem etablierten Titel „Sagen und Geschichten aus der Westeifel“ eine Neuausgabe im Umfang von 688 Seiten.[1]
Es geht im Rahmen dieser Studie um wissenschaftliche Netzwerke. Es geht um eine Dissertation, um eine Sammlung von Sagen und Märchen, die ein junger Mann in seiner Eifelheimat zusammentrug. Sie entstand an dem 1920 neu gegründeten Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, das am wissenschaftlichen Austausch nicht nur mit den Fachkollegen, sondern auch mit einem großen und interessierten Kreis von Lehrern, Pfarrern und Heimatforschern interessiert war. Die Dissertation war nicht nur eingebunden in die Arbeit an einem fächerübergreifend arbeitenden Institut, das sich in den Jahren nach seiner Gründung in einer Aufbruchsstimmung befand, sondern auch in die jahrzehntelange Kärrnerarbeit am „Rheinischen Wörterbuch.“ Ein weiterer wichtiger Partner der Sagensammlung war der Eifelverein, der sich neben dem Wandern und der touristischen Erschließung der Eifel auch deren wissenschaftliche Erforschung auf seine Fahnen geschrieben hatte. Der Verein gründete in den 1920er Jahren in Mayen ein Museum und eine Bibliothek, gab Bücher heraus und öffnete das Eifelvereinsblatt und den Eifelkalender auch Fachwissenschaftlern, die Themen der Geologie, Flora und Fauna, Kirchen- und Kunstgeschichte, Landesgeschichte und Volkskunde einem breiten Publikum vermittelten. Der Vorsitzende des Eifelvereins, Karl Leopold Kaufmann (1863-1944), stand in enger Verbindung mit dem Direktor des Bonner Instituts, Franz Steinbach, organisierte und besuchte landeskundliche Tagungen und veröffentlichte zahlreiche landeskundliche Aufsätze und Bücher.
Drei Jahre nach dem Beginn des Sagenprojekts kam das verhängnisvolle Jahr 1933. Was folgt, ist eine Geschichte von Blauäugigkeit, Naivität, Begeisterung, Entdeckerfreude, Sendungsbewusstsein, einer gehörigen Portion Opportunismus, dem Wunsch nach einer Karriere oder zumindest des Versuchs, zu Überleben. Was die sogenannte „Westforscher“ seit den 1920er Jahren über das Elsass, das Saarland, Luxemburg, Eupen-Malmedy, die deutschsprachige Gegend um Arlon oder die Niederlande herausgefunden zu haben glaubten, fügte sich wunderbar in die politischen Pläne der neuen Machthaber. Es bot sich die Aussicht auf Forschungsmittel, Stipendien, Assistentenstellen und Lehrstühle, neue Aufgaben wie Projekte, Publikationen und Ausstellungen oder wenigstens eine UK-Stellung im Krieg. Ohne dass man im Einzelfall die push- und pull-Faktoren auseinanderdividieren kann: Eine ganze Generation von Wissenschaftlern wurde zu gut geölten Rädchen in der Wissenschaftsorganisation des „Dritten Reichs“, die zum Teil schon unmittelbar nach Kriegsbeginn (Luxemburg), zum Teil aber erst nach dem „Endsieg“ eine Neuordnung Europas rechtfertigen sollte.
Ein weiteres Rädchen in diesem System war der Eifelverein. Aufgrund seiner Tradition vereinigte er überwiegend Angehörige der staatstragenden preußischen Eliten und stand katholischen, sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Kreisen fern. Diese Schicht wählte eher die NSDAP als beispielsweise die Bewohner der katholisch geprägten Eifel. Ein Karl Leopold Kaufmann musste 1933 nicht groß gleichgeschaltet werden, sondern konnte fortan den jetzt nach dem Führerprinzip organisierten Verein weiter-„führen“. Nicht nur durch seine Person bedingt – er war früher preußischer Landrat in Malmedy und Euskirchen gewesen – trat der Verein für die Rückkehr von „Neu-Deutsch-Belgien“ ins Reich ein und war durch seine wissenschaftlichen Ambitionen auch den Zielen der „Westforschung“ eng verbunden. In den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und im Reichsnährstand des „Dritten Reichs“ sah der Verein die Verwirklichung seiner 1888 gesteckten Ziele einer Wirtschaftsförderung der Eifel. Gerne stellte er den neuen Machthabern seine Publikationsorgane zur Verfügung, um deren Leistungen in der Region zu vermarkten. Im Gegenzug wurde der Eifelverein gerade bei seiner Kulturarbeit großzügig unterstützt, zum Beispiel mit 30.000 RM als Geburtstagsgeschenk zum Erwerb der Genovevaburg in Mayen, die das Eifelmuseum beherbergt. In den 1930er Jahren wurde der Eifelkalender an Separatisten in „Deutsch-Belgien“ geliefert, in den 1940er Jahren an die Soldaten der Wehrmacht.
Es stellt sich die für Angehörige späterer Generationen nicht ganz einfach zu beantwortende Frage nach der individuellen Schuld beziehungsweise dem Ausmaß der Verstrickung. Die Fachvertreter der „Westforschung“ waren keineswegs eine homogene Gruppe, ihre Vertreter traten mehr oder minder freiwillig in den Dienst des Regimes und engagierten sich in unterschiedlichem Ausmaß. Die „Westforschung“ entstand in einem spezifischen historischen Kontext, der sich durch die Schlagworte verlorener Krieg und Vertrag von Versailles, Verlust von Elsass-Lothringen und Eupen-Malmedy sowie entmilitarisiertes Rheinland, Separatismus und Ruhrkampf charakterisieren lässt.
Die „Westforschung“ besitzt auch eine andere Seite, die der Kollegen in Frankreich, Belgien, Holland und Luxemburg, mit denen man teilweise eng kooperierte, die man zum Teil aber auch massiv attackierte. Weiter hatte sich die „Westforschung“ bereits vor 1933 etabliert, und sie wurde auch von Personen getragen, die die NS-Ideologie ablehnten. Nach 1933 gibt es noch zeitliche Veränderungen, einmal eine Phase der Begeisterung und Assimilierung, dann in einigen Fällen einen Prozess der Erkenntnis, sich in dem neuen Regime geirrt zu haben, weiter die Beobachtung, dass sich das „Dritte Reich“ notfalls mit Gewalt und gegen geltendes Recht gegen innere und äußere Widerstände behauptete und sich die Frage nach dem eigenen Überleben stellte.
Man findet Seite an Seite den umtriebigen Franz Steinbach und den eher stillen Gelehrten Matthias Zender. Beide stammten aus katholischen Bauernfamilien, was sie Zeit ihres Lebens prägte. Steinbach machte Karriere, trat aber nicht der NSDAP bei, der völlig unpolitische Zender wurde Mitglied, was aber seine Parteigenossen nicht davon abhielt, seine Karriere zu behindern. Und schließlich ging die individuelle Biographie in fast allen Fällen auch nach dem Krieg weiter. „Persilscheine“ wurden ausgestellt, Beteiligte entnazifiziert, alte Positionen wiederlangt und neue Tätigkeiten gefunden. Dabei war es eine Frage des Überlebens, die eigene Geschichte ins rechte Licht zu rücken. Vieles wurde verschwiegen, anderes beschönigt. Die Nachkommen der „Westforscher“, Kinder wie Schüler, standen vor einer Wand des Schweigens – ein Schicksal, das sie mit vielen Nachkommen von Soldaten und Flüchtlingen teilten.
Wo die mündliche Tradition schweigt, unvollständig oder unglaubwürdig ist, kann sich die Generation der Nachkommen mit der schriftlichen Überlieferung befassen. Viele Akten wurden im und nach dem Krieg zerstört, andere „gesäubert.“ Dennoch sind zum Thema dieser Untersuchung noch weitaus mehr Unterlagen vorhanden, als ausgewertet werden konnten. Der Nachlass von Matthias Zender, der in Kartons auf dem Dachboden des ehemaligen Instituts für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande der Universität Bonn lagert, ist nur ein Beispiel. Zudem waren die Protagonisten dieser Studie begeisterte Wissenschaftler, die zahlreiche Tagungen organisiert, Vorträge gehalten und einen Berg von Büchern, Aufsätzen und Rezensionen hinterlassen haben. Papier ist geduldig. Die „Rheinischen Vierteljahrsblätter“ (RhVjbl) blieben genauso lückenlos erhalten wie „Die Eifel“ (DE) und der „Eifelkalender“ (EK). Man mag sich damit herausreden, dass mancher Kotau vor den Machthabern den Zeitumständen und den Machthabern, die schließlich die Geldgeber der „Westforschung“ darstellten, geschuldet waren, doch lohnt es sich stets, die Veröffentlichungen selbst in ihrer ganzen Länge zu lesen, nach ihren Quellen zu fragen und sie mit Arbeiten aus der Nachkriegszeit zu vergleichen.

Matthias Zender, Porträtfoto, um 1987, Foto: Hans Schafgans, Bonn. (Privatbesitz)
Auch bei den Veröffentlichungen, Periodika und Reihen zeigt sich eine geradezu erschreckende Kontinuität, und zwar nicht nur der Personen und Institutionen, sondern auch der Themen und Forschungskonzepte. Viele „Westforscher“ waren junge Leute. Sie sahen in ihr eine große Chance und standen am Ende des Zweiten Weltkrieges im besten Mannesalter; Frauen wie Edith Ennen waren eine Minderheit. In den 1950er und 60er Jahren saßen sie dann an den Schaltstellen der Institute und Forschungseinrichtungen und beherrschten mit ihren langjährigen Weggefährten, Schülern und Enkeln den wissenschaftlichen Markt[2].
Auch der Eifelverein tat sich mit seiner Vergangenheit schwer, wurde doch der Vorsitzende der Jahre 1938 bis 1945 – der Schleidener Landrat Josef Schramm (1901-1991) –1954 wiedergewählt und bekleidete dieses Amt bis 1973, als Ehrenvorsitzender sogar bis 1991. Wie hätte man sich da beim Vereinsjubiläum 1988 kritisch mit der eigenen Geschichte befassen können? Erst in der Festschrift zum 125-jährigen Vereinsjubiläum konnte 2013 die Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit aufgearbeitet werden. Zudem konnte der Eifelverein nach dem Krieg als Heimatorganisation in einer nach Orientierung suchenden Gesellschaft Punkte sammeln. In den 1980er und 90er Jahren wurde Wandern zu einem Massensport, zudem etablierte sich der Eifelverein als Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutzorganisation. Doch die Professionalisierung und Kommerzialisierung des Wandertourismus und die sinkende Faszination der Organisationsform Verein machen auch ihm zunehmend zu schaffen.
Das Bonner Institut tat sich mit der eigenen Vergangenheit ebenfalls schwer, zumal es seit den 1970er Jahren nach und nach seine führende Position verlor und schließlich aufgelöst wurde. Bis 1974 beziehungsweise 1991 saßen die Steinbach-Schüler Edith Ennen und Georg Droege (1929-1993) auf dem Lehrstuhl, ihre Nachfolger Wilhelm Janssen (geboren 1933) und Manfred Groten (geboren 1949) gehören nicht nur anderen Generationen, sondern auch jeweils einer anderen „Schule“ an. Den Zender-Lehrstuhl hatte bis 2000 sein Schüler Heinrich L. Cox (geboren 1935) inne. 2005 wurde das Institut aufgelöst, die Rheinische Landesgeschichte ist seitdem eine Abteilung des Instituts für Geschichtswissenschaft, die Volkskunde als Abteilung für Kulturanthropologie/Volkskunde am Institut für Archäologie und Kulturanthropologie angesiedelt.
Mit Fragen der Institutsgeschichte hat sich in den letzten Jahren mehrfach Marlene Nikolay-Panter befasst, die sich als Droege-Schülerin dem Kreis der Enkelinnen zurechnet. 2006 fand eine Herbsttagung mit dem Thema „Landesgeschichte auf dem Prüfstand“ statt, die Vorträge wurden 2007 unter dem Titel „Rheinische Landesgeschichte an der Universität Bonn. Traditionen – Entwicklungen – Perspektiven“ veröffentlicht. Damit ist das Forschungsfeld, wie der folgende Beitrag zeigt, aber noch lange nicht „abgegrast.“ In der Vorkriegszeit ist noch Vieles zu erforschen, in der Nachkriegszeit ist noch fast alles unerforscht. Freilich sollten gerade auch Historiker neben der Vergangenheit auch die Zukunft im Blick haben. Alois Gerlich fragte sich in einer Rezension, ob der Tagungsband einen „Schwanengesang“ darstellt, und in der Tat überwiegt die Retrospektive, die Beschwörung vergangener Größe in der Zeit der Gründerväter, ein Phänomen, das man auch in der Geschichtsschreibung mittelalterlicher Klöster in Zeiten von Krise und Niedergang beobachten kann. Gerlich schloss mit der Aufforderung, die Fenster des universitären Elfenbeinturms zu öffnen: „Hier sind Universitäten, Staatskanzleien, Ministerien, nachgeordnete Behörden, Vereine und Gesellschaften, Stadt- und Gemeinderäte angesprochen und eingeladen zur Lektüre im Sinne der Bildungspolitik unserer Gegenwart.“[3] Um diese Institutionen davon zu überzeugen, Geld für die Forschung auszugeben, bedarf es allerdings sowohl von Seiten der Landesgeschichte als auch der Volkskunde überzeugender Konzepte.
2. Wer war Matthias Zender?
Wer war der Bonner Doktorand, der die Leser für die Geschichten seiner Eifelheimat begeistern konnte? Matthias Zender wurde am 20.4.1907 als Sohn des Bauern Peter Zender und seiner Frau Anna Maria Thielen in Niederweis geboren[4]. Niederweis liegt in der heutigen Verbandsgemeinde Irrel im Eifelkreis Bitburg-Prüm, nahe der Luxemburger Grenze, 13 Kilometer südlich von Bitburg und 9 Kilometer nördlich von Echternach. Heute leben dort 250 Einwohner. Das Dorf besitzt römische Siedlungsreste. Der Turm der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist stammt aus dem 12. Jahrhundert, die Kirche selbst wurde 1846 errichtet. Neben Bauernhäusern und Wegekreuzen ist noch das barocke Schloss zu erwähnen, das Franz Eduard Anton Freiherr von der Heyden (1693-1755), Präsident des Luxemburger Provinzialrates, 1751 errichten ließ. In Niederweis gab es also alles, was zu einem typischen Eifeldorf gehörte.
Dazu zählte auch die Kirche St. Johannes Evangelist. Zender blieb Zeit seines Lebens nicht nur in der bäuerlichen Welt seiner Eifelheimat, sondern auch im katholischen Glauben verwurzelt. Dies brachte bereits sein Vorname zum Ausdruck: Der heilige. Matthias ist der populärste Heilige im Bistum Trier, zahlreiche Prozessionen ziehen noch heute jedes Jahr durch die Eifel zum Grab des Apostels in Trier.

Edith Ennen, Porträtfoto, undatiert.
Trier war dann auch die nächste Station seiner Vita: Nach dem Besuch der Volksschule in Niederweis wechselte Zender an Ostern 1919, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, an das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier[5]. Dieses galt als Rekrutierungsbecken für das Trierer Priesterseminar. Klassenkameraden von Zender waren der spätere Kölner Erzbischof und Kardinal Joseph Höffner und der spätere Pfarrer von Butzweiler und bekannte Erforscher der religiösen Volkskunde der Eifel, Nikolaus Kyll (1904-1973)[6] . Bereits 1919 begeisterte ihn sein Lehrer Josef Steinhausen (1885-1959) [7] für die Sprachforschung und vermittelte den Kontakt zu dem Leiter des Rheinischen Wörterbuches, Professor Dr. Josef Müller (1875-1945), in Bonn [8].
2.1 Schulzeit, Studium und Promotion
Zender studierte von 1926 bis 1928 in Bonn, 1928 in Innsbruck, 1928 bis 1929 in Wien und dann wieder von 1929 bis 1933 in Bonn Volkskunde, Geschichte und Germanistik. Seit 1927 gehörte er der katholischen Studentenvereinigung Unitas Salia an. Am 1.11.1929 wurde er „wissenschaftlicher Hilfsarbeiter“ an der rheinischen Landesstelle des Deutschen Volkskundeatlas; ihr Leiter war sein Förderer Josef Müller. Diese Stelle bekleidete der inzwischen 22-Jährige für genau zehn Jahre [9]. Erst nach dem Erscheinen der „Volkssagen“ und der „Volksmärchen“ promovierte Zender, der bis dahin bereits 23 Aufsätze veröffentlicht hatte, 1938 mit der Arbeit „Die Sage als Spiegelbild von Volksart und Volksleben im westlichen Grenzland. Ein Beitrag zur Volkskunde von Eifel und Ardennen“ (Teildruck Bonn 1940) [10].

Matthias Zender mit Nikolaus Kyll in Speicher (Eifel), 1970. (Archiv Wolfgang Zender)
Mit Bonn, der Musteruniversität der preußischen Rheinprovinz, hatte Zender eine gute Wahl getroffen. 1920 gründeten hier der Historiker Hermann Aubin und der Sprachwissenschaftler Theodor Frings das Institut für geschichtliche Landeskunde, das die Geschichte der Rheinlande fächerübergreifend in Kooperation mit der historischen Geographie, der Volkskunde und Sprachgeschichte und auch der Kunstgeschichte erforschen wollte. Die Untersuchungen waren nicht nur fächer-, sondern auch raum- und grenzüberschreitend angelegt und sollten einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werden [11]. Auch wenn Aubin 1925 nach Gießen und Frings 1927 nach Leipzig berufen wurde, hatte damit eine Erfolgsgeschichte begonnen [12] . Aubins Nachfolger wurde der erst 31-jährige Historiker Franz Steinbach, der 1926 die Leitung des Instituts übernahm und nach seiner Berufung auf ein Extraordinariat auch zum Direktor ernannt wurde, ein Amt, das der wegen seiner Rolle in der „Westforschung“ nicht ganz unumstrittene, aber einflussreiche Historiker bis 1960 innehatte [13].
Aubin und Frings stießen zahlreiche Projekte an: Bereits 1922 gab Aubin eine zweibändige „Geschichte des Rheinlandes von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart“ heraus, deren erster Band sich mit der politischen und deren zweiter sich mit der Kulturgeschichte befasste. Themen waren unter anderem die Stadt- und Agrargeschichte, Gewerbe, Handel und Verkehr, die Sprachgeschichte, das Geistesleben und die Kunstgeschichte. Der von Aubin und Frings mit dem Volkskundler Josef Müller erarbeitete Band „Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden“ war eine imposante Zusammenschau der Geschichte, Sprache und Volkskunde eines Kulturraumes, bei deren Erforschung auch die kartographische Methode eine große Rolle spielte[14].

Diss. von Matthias Zender, Karteikarte. (Nachlass Matthias Zender)
Ebenfalls 1926 gab Aubin den von dem Bonner Lehrer Josef Niessen (1864-1942) erarbeiteten „Geschichtlichen Handatlas der Rheinprovinz“ heraus [15]. Ab 1922 konnten in der neu begründeten Buchreihe „Rheinisches Archiv“ zahlreiche Qualifikationsarbeiten veröffentlicht werden; erster Band war die Dissertation von Franz Steinbach [16]. Ab 1922 erschienen die „Rheinischen Neujahrsblätter“ und ab 1926 das Mitteilungsblatt „Geschichtliche Landeskunde“, aus denen dann die 1931 begründeten „Rheinischen Vierteljahrsblätter“ hervorgingen, bei denen Zender von Anfang an mitarbeitete [17].
1925 wurde der „Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande“ gegründet, der bereits 1928 613 persönliche und 224 korporative Mitglieder zählte [18]. Bei der Gründung des Instituts war von Anfang an eine große Breitenwirkung angestrebt; es verstand sich als „heimatgeschichtliches Institut an der rheinischen Universität“ [19] . Aubin wollte eine „Vernetzung von Heimatforschung und universitärer Landeskunde“ [20]. Er veranstaltete ab 1922 „akademische Ferienkurse“, die weitaus mehr Besucher anzogen als die heutigen Institutstagungen. Die zunächst dreitägigen Kurse wurden von Bonnern und auswärtigen Referenten gestaltet. 1925 war das Rahmenthema die „Kulturströmungen“, worüber neben Aubin, Frings und Müller auch der Kunsthistoriker Heribert Reiners (1884-1960) referierte [21]. 1927 ging es um die Siedlungsgeschichte und 1928 unter Federführung von Bruno Kuske um die Wirtschaftsgeschichte. 1929 lautete das Rahmenthema „Rheinische Volkskunde.“ An drei Tagen gab es 13 Vorträge in drei Sektionen über die Aufgaben und Methoden der Disziplin, über Volkskunst sowie über Volksglauben und -brauch. 1934 ging es um Saarfragen und bei dem Lehrgang ohne Themenschwerpunkt von 1937 sprach Zender über die Volkskunde in den westdeutschen Grenzlanden. 1951 referierten Franz Steinbach, Karl Meisen (1891-1973), Adolf Bach (1890-1972) und Matthias Zender [22].

Diss. von Matthias Zender, Titelblatt. (Nachlass Matthias Zender)
Parallel dazu gab es die Arbeitstagungen der Westdeutschen Forschungsgemeinschaft (WDF), die sich vorwiegend mit Fragen der „Westforschung“ befassten [23]. 1935 fand in Bonn die zweite volkskundliche Tagung statt, zu der Steinbach auch Fachleute aus Belgien und den Niederlanden eingeladen hatte. Adolf Bach referierte über die Namensforschung und Zender über die „geographische Verbreitung der Volkssage in der Westeifel.“ 1938 ging es in Gerolstein vor allem um das Deutschtum in Belgien, namentlich in Eupen-Malmedy. Zender sprach über das Deutschtum in Arlon und überlegte, wie man der „Verwelschungspolitik des belgischen Staates“ begegnen könne. Er forderte ein umfangreiches Schul- und Bildungsangebot und monierte das mangelhafte Engagement des Deutschen Reichs auf diesem Gebiet, um das Deutschtum wiederzuerwecken. Man müsse hier gänzlich anders vorgehen als in Eupen-Malmedy, folgerte er unter „lebhaftem Beifall.“ In seinen Veröffentlichungen ist er nie durch so konkrete Forderungen hervorgetreten [24].
Georg Mölich kam zu dem Ergebnis: „Das Bonner Institut war im ersten Jahrzehnt seines Bestehens im Gegensatz zu der bis heute dominierenden retrospektiven Wahrnehmung deutlich mehr auf öffentliche geschichtspolitische und landeskundlich-didaktische Wirkung als auf fachwissenschaftliche Erträge im engeren Sinne hin ausgerichtet.“ [25]
Es gelang Aubin, Frings und Steinbach zunächst nicht, einen ordentlichen Lehrstuhl für Volkskunde einzurichten. Ab 1935 war Karl Meisen außerordentlicher Professor, wurde aber 1939 aus dem Amt entfernt und kehrte erst 1945 zurück; 1947 wurde er auf ein Extraordinariat und 1948 auf ein Ordinariat berufen [26]. Er strebte eine breite Wirkung seiner Forschungstätigkeit auch bei den Heimatforschern an und gründete 1948 die Rheinische Vereinigung für Volkskunde, die das „Rheinische Jahrbuch für Volkskunde“ herausgab.1954 wurde auch die „Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde“ (RWZ) neu begründet; für beide Periodika verfasste Zender mehrere Beiträge.
Wichtiger für Zender war bereits seit seiner Schulzeit Josef Müller, der 1914 das 1904 von der Preußischen Akademie der Wissenschaften begründete Rheinische Wörterbuch übernommen hatte, das 1930 als selbstständige dritte Abteilung dem Bonner Institut eingegliedert wurde. Müller war von 1903 bis 1907 Lehrer am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier, wo er ebenso wie Steinhausen in den Pausen den Wortschatz seiner Schüler aufzeichnete. Danach war er in Bonn tätig [27]. 1925 wurde er Lehrbeauftragter und von 1927 bis zu seiner Pensionierung 1940 war er Honorarprofessor. Neben seinem Hauptwerk, dem „Rheinischen Wörterbuch“, ist sein grundlegender Beitrag zur Sprachgeschichte in den „Kulturströmungen“ zu nennen [28].

Diss. von Matthias Zender, Musterseite. (Nachlass Matthias Zender)
Erwähnt werden muss weiter Adolf Bach, der 1927 an die Pädagogische Akademie und als Privatdozent an die Universität Bonn berufen wurde; hier leitete er als Nachfolger von Frings die Abteilung für Mundartforschung und Volkskunde. 1931 wurde er außerordentlicher Professor und 1941 an die „Reichsuniversität Straßburg“ berufen [29].
Zu nennen ist schließlich noch Hans Naumann (1886-1951), der neben Josef Müller Zweitgutachter von Zenders Dissertation war. Der Altgermanist hatte zahlreiche Werke zur mittelalterlichen, aber auch zur Gegenwartsliteratur verfasst und war durch seine Theorie vom gesunkenen Kulturgut bekannt geworden. 1932 wurde er von Frankfurt nach Bonn berufen, war Mitunterzeichner einer Erklärung 51 deutscher und österreichischer Professoren für Adolf Hitler (1889-1945), trat 1933 in die NSDAP und 1935 in den NSD-Dozentenbund ein. 1933 hielt er bei der Bücherverbrennung eine Rede. Sieben der Bonner Kriegsvorträge stammen aus seiner Feder. Als Rektor wurde er wegen mehrerer Konflikte um die Entlassung des Theologen Karl Barth (1886-1968) und um die Aberkennung der Ehrendoktorwürde des Schriftstellers Thomas Mann (1875-1955) abgesetzt. 1946 wurde er von der Besatzungsmacht entlassen [30]. Ein eigener Lehrstuhl für Volkskunde wurde 1942 eingerichtet und mit dem linientreuen Erich Röhr (1905-1943) besetzt, der in Bonn ebenso wenige Spuren hinterlassen hat wie sein 1944 berufener Nachfolger Joseph Otto Plassmann (1895-1964) [31].
2.2 Assistentenzeit in Bonn (1939/1940)
1939 wurde Zender Assistent an der Universität Bonn. Von 1932 bis 1933 war er wahrscheinlich Mitglied der Zentrumspartei oder stand ihr zumindest nahe, 1933 trat er in die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt und in den Nationalsozialistischen Lehrerbund ein; 1937 erklärte er seinen Eintritt in die NSDAP und wurde 1940 Mitglied im NSD-Dozentenbund [32].

Diss. von Matthias Zender, Karte d. Verbreitung v. Erzählern u. Erzählungen im Bitburger Land. (Nachlass Matthias Zender)
Zenders Assistentenzeit begann am 1.4.1939. Er wurde somit Nachfolger von Martin Herold (1896-1977) und Kollege von Fritz Textor (1911-1988) [33]. Steinbach hob in seinem Antrag an die Fakultät Zenders besondere Qualifikation hervor und seine Befähigung zur Habilitation [34]. Daneben enthält die Akte Lebenslauf, Fragebogen, Arbeitsvertrag mit Gehaltsberechnung, eine Bescheinigung der NSDAP über seine Mitgliedschaft seit dem 1.5.1937, eine Stellungnahme der Dozentenschaft, die ihm bei seinen Arbeiten „außerhalb der deutschen Westgrenze […] Zuverlässigkeit“ bescheinigt und die seine „politische Haltung […] einwandfrei und […] durchaus positiv“ beurteilte sowie einen Nachweis über sein Treuegelöbnis. Am 20.12.1939 heiratete Zender die Lehrerin Clara Neyses (1909-1992). 1943 wurde die Tochter Adelheid (gestorben 1996), 1950 der Sohn Wolfgang geboren.
Die Stellungnahme der Dozentenschaft ist mit „W. Busch“ unterzeichnet. Die Spur führt zunächst nicht weiter, weil auch der Name Wilhelm Busch nicht eben selten ist. In der Korrespondenzmappe Franz Petris findet sich das Schreiben eines W. Busch aus dem hessischen „Hohenroda, Post Mansbach, über Hünfeld-Land“ vom 23.7.1947. Beiliegend übersandte er ein „Entlastungsschreiben“ und erläuterte, der SD habe 1941 ein Verfahren gegen ihn eingeleitet, weil er [als Vorsitzender der Dozentenschaft] „konfessionelle und parteifeindliche Kreise betont gefördert, parteilich gebundene und namentlich SS-Kreise“ aber benachteiligt habe. Nach zwei „sehr unangenehmen Verhören“ sei er bei der Wehrmacht untergetaucht. Dann rechtfertigt er sein Verhalten, in Abstimmung mit den Fakultäten seien häufig „Nicht-Pgs.“ berufen worden, da Parteigenossen „bekanntlich nicht zu den exakten Wissenschaftlern“ zählen.“ Er habe sich auch schützend vor eine Reihe von Professoren und Dozenten (Camille Wampach, 1884-1958) gestellt [35].
Der Akte liegt ein undatierter und nicht unterschriebener „Entwurf“ bei. Darin erklärte Steinbach, er sei niemals Mitglied der NSDAP gewesen und habe deren Politik stets abgelehnt. Er stellt Busch ein tadelloses Zeugnis aus, in dem er erwähnt, dieser habe 1939 auch seinen Assistenten unterstützt. Weiter liegt der Akte eine eidesstattliche Erklärung [Steinbachs] vom 16.9.1947 bei. Busch habe sich „im Jahre 1939 schützend vor einen Assistenten des von mir geleiteten Instituts für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande“ gestellt, „der aus nationalsozialistischen Studentenkreisen wegen seiner weltanschaulichen und wissenschaftlichen Haltung angegriffen wurde.“ Auch Steinbachs Entlassung als Professor und Institutsdirektor habe er 1940 verhindert. Seine Tätigkeit in der „Bonner Dozentenführung“ lasse seine Distanz zur Partei erkennen.
Die wenigen Textauszüge müssen genügen, es ist hier nicht der Ort, die Tätigkeit Wilhelm Buschs näher zu untersuchen. Er war seit 1930 Assistent am Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre an der damaligen landwirtschaftlichen Hochschule Bonn-Poppelsdorf. 1936 habilitierte er sich und erhielt eine Dozentur für landwirtschaftliche Betriebslehre, Agrargeographie und Agrargeschichte. Er hielt seine Lehrprobe zur Geschichte der Schafzucht und eine Antrittsvorlesung zu Fragen des ländlichen Siedlungsgefüges im Rheinland. Es bestanden womöglich mit Zender und Steinbach gemeinsame Interessen. Busch war Mitglied der NSDAP und ist erstmals 1939 als „Führer des N.S. D. Dozentenbundes“ belegt. 1942 wurde er nicht ohne Widerstände auf den Lehrstuhl für landwirtschaftliche Betriebslehre berufen, 1942 als Direktor an die Baltische Forschungsanstalt in Riga abkommandiert und am 8.5.1945 in den „Wartestand“ versetzt. Von 1945 bis 1947 war er für das Zentralamt für Ernährung und Landwirtschaft in der Britischen Besatzungszone in Hamburg tätig. Trotz seiner Entnazifizierung am 12.9.1947 („entlastet“) wurde er nicht wieder eingestellt und arbeitete für einen Hamburger Verlag. 1950 wurde er Professor für gärtnerische Betriebslehre an der damaligen TH Hannover [36].
Zu Zenders Aufgaben als Assistent zählte auch die Schriftleitung der Rheinischen Vierteljahrsblätter. Am Ende des ersten Doppelheftes verabschiedete sich sein Vorgänger Martin Herold im Juni 1939 von den Lesern mit dem Gefühl der „Genugtuung“, dass es ihm beziehungsweise der Zeitschrift in den acht Jahren, in denen er seit Heft 4 (1931) die „Schriftwaltung“ innehatte, gelungen sei, die hoch gesteckten „volksgeschichtlichen Ziele“ zu erreichen. Als Nachfolger stellte er Zender vor [37]. Zu dessen Aufgaben gehörte auch die Betreuung des Rezensionsteils. Zender, der schon von 1931 an regelmäßig Besprechungen geschrieben hatte, legte sich 1939 dann richtig ins Zeug. Bis zum Krieg verfasste er 15 Rezensionen, davon mehrere für die Zeitschrift des Vereins für rheinische und westfälische Volkskunde und einige für die Rheinische Heimatpflege, die Zeitschrift des Volksbundes für das Deutschtum im Auslande und die Westdeutsche Zeitschrift für Volkskunde, vor allem aber für die Rheinischen Vierteljahrsblätter [38].

Matthias Zender, 1936. (Archiv Wolfgang Zender)
Hier besprach er 1931 die Saarländische Volkskunde von Nikolaus Fox (1899-1946) und bemängelte dabei, dass die lange Zeit wirksamen kulturellen Zusammenhänge mit dem südwestdeutschen Raum nicht genug herausgestellt seien. Dass Zender an dem unter anderem von Aubin und Steinbach im Auftrag der Saar-Forschungsgemeinschaft und dem Bonner Institut herausgegebenen Saar-Atlas mitgearbeitet hat, kann hier nur am Rande erwähnt werden. Er bearbeitete Karten der Marienwallfahrtsorte, des Pfingstquak, des Maibaumes, der Mädchenlehen, der Erntefeste sowie der Wendelinusverehrung und kam zu dem Ergebnis, „daß nicht nur die Sprache, sondern auch die Volkskultur der Saarlande rein deutsch ist.“ [39]
1933 rezensierte Zender die bereits 1926 und 1928 erschienenen ersten beiden Bände von Louis Pincks (1873-1940) Lothringer Volksliedern. Ihn beeindruckte die Fülle des zusammengetragenen Materials beispielsweise über die Volksliedsänger, das deutlich mache, dass die Volkslieder „rein deutschen Ursprungs“ seien. 1934 und 1941 werden auch die folgenden beiden Bände ausführlich gewürdigt und mit einer Bibliographie des 1940 verstorbenen Pinck versehen [40]. Weniger positiv ist Zenders Urteil über die Dissertation von Leo Hilberath (1903-1967) über die Junggesellenvereine der Eifel: Da dieser weder die Sammlungen des Rheinischen Wörterbuchs noch die Ansätze der Kulturraumforschung oder auch „Naumanns Lehren“ zur Kenntnis genommen habe, ließen sich seine soziologischen Erkenntnisse vielfach vertiefen.
1939 veröffentlichte Zender einen kleinen Literaturbericht zu westdeutschen (!) Sagensammlungen. Besprochen wird eine Sammlung von 100 Sagen und Liedern aus der Gegend von Arlon (!) von Nikolaus Warker (1861-1940), den Zender sehr schätzte. Sie waren zwar schon 1931 bis 1933 in der Hémecht erschienen, sind aber in keiner „reichsdeutschen Zeitschrift angezeigt worden.“ Deshalb listet Zender weitere Arbeiten Warkers auf. Weiter bespricht er Gottfried Henssens (1889-1976) Münsterländische Sagen, die zumeist Märchen seien, und Karl Lohmeyers (1878-1957) Sagen von Saar, Blies und Nahe. Den Abschluss bildet der zweite Band von Angelika Merkelbach-Pincks (1885-1972) Lothringer (!) Sagen, Schwänke und Bräuche.
1939 rezensierte Zender recht positiv das Siegerländer Wörterbuch und eher kritisch die letzten beiden Bände von Arnold van Genneps (1873-1957) Handbuch der französischen Volkskunde. Zwar war Zenders abschließendes Urteil sehr positiv, aber das Kapitel über das Elsass hat er massiv kritisiert, da die Ergebnisse der aktuellen „Westforschung“ (Steinbach 1939!) nicht genügend rezipiert worden seien: „Das Volkstum zur Begründung für die Zugehörigkeit des Elsaß zu Frankreich anzuführen, erscheint abwegig und vollkommen aussichtslos.“ Da aber zahlreiche „Beziehungen und Verflechtungen“ bestünden, seien die deutsche und die französische Volkskunde auf eine enge Kooperation angewiesen, „weil neuere Arbeiten den recht bedeutenden volksmäßigen Anteil der Germanen beim Aufbau des französischen Volkes und der französischen Kultur dargetan haben.“

Hermann Aubin, undatiert. (Universitätsarchiv Bonn)
Ähnliche Töne finden sich in Franz Petris Artikel „Offener Brief an einen wallonischen Gelehrten“, der im Oktober 1939 (!) in den Rheinischen Vierteljahrsblättern den belgischen Romanisten und Mediävisten Maurice Wilmotte (1861-1942) zurechtwies und jede Unterstellung, die „Westforschung“ würde eine „militärische und politische Eroberung“ vorbereiten, zurückwies [41].
Zender wollte sich habilitieren. Geplant war eine Arbeit über das Thema „Volkskunde des westdeutschen Grenzlandes“ zwischen Aachen und den Vogesen. Er wollte seine Forschungen zu Arlon, Malmedy, St. Vith und Luxemburg ausbauen und die Unterschiede zwischen Deutschen, Franzosen und Wallonen herausarbeiten. Hierzu fragte er nach einer Förderung durch den „Volksbund für das Deutschtum im Ausland.“ Dieser sollte die Kosten für längere Archiv- und Bibliotheksreisen nach Brüssel und Paris übernehmen. In einem ausführlichen, bis auf einen kleinen Angriff gegen die „Thesen der französischen Kulturpropaganda“ völlig unpolitischen Schreiben wandte er sich am 20.12.1938 an die Provinzialverwaltung. Der zuständige Leiter der Kulturabteilung war der Kunsthistoriker und SA-Oberführer Dr. Hans Joachim Apffelstaedt (1902-1944?), der im gleichen Jahr auf der 50-Jahrfeier des Eifelvereins eine Rede gehalten hatte und das Eifelmuseum in Mayen mit einem namhaften Betrag förderte. Er gab das Schreiben an die SS-Forschungsgemeinschaft Ahnenerbe, zu der er recht enge Beziehungen hatte, mit der Bitte um Stellungnahme weiter. Diese lehnte eine Förderung mit allem Nachdruck ab, da Zender der katholischen Studentenvereinigung Unitas-Salia angehöre und anlässlich seines Studienaufenthaltes in Innsbruck Mitglied der „Heimwehr“ gewesen sein solle. Zudem hätte er sich unberechtigterweise als Mitarbeiter des Ahnenerbes bezeichnet. Apffelstaedt wies am 7. März den Gaudozentenführer, den Mineralogen und Rektor der Universität, Karl F. Chudoba (1898-1976), darauf hin, dass in Bonn in Zusammenarbeit mit dem Ahnenerbe die Einrichtung eines Lehrstuhls für Volkskunde geplant sei, der eine „eindeutig klare weltanschauliche Linie“ habe. Eine Zusammenarbeit des Amtsinhabers mit Zender sei deshalb unzumutbar. Am 9. März schrieb der Gaudozentenführer zurück, Zender könne sich in Bonn gar nicht habilitieren, da es hier kein volkskundliches Ordinariat gebe. Weiter erklärte er sich bereit, bei der Beschaffung ablehnender Gutachten behilflich zu sein.
Ein weiteres Schlüsseldokument befindet sich in einem Konvolut von Akten und Briefen aus dem VDA. Sie betreffen Kriegsgefangene aus der Gegend von Arlon (1941), eine Exkursion mit Bonner Studenten ins westliche Grenzland (1939) und ein Flugblatt des Bundes der Deutsch-Belgier zur Einweihung eines Denkmals für den 1847 geborenen und 1916 gestorbenen Historiker Gottfried Kurth in Arlon (1939). In der Akte befindet sich weiter ein Schreiben der Reichstudentenführung, Außenstelle West in Köln, vom 16.2.1939, mit dem Landesrat Rudolf Hilgers eine Stellungnahme des Personalamtes der Studentenführung der Universität Bonn vom 4. Februar übersandt wurde [42]. Die Schriftstücke gehören wohl in den eben skizzierten Kontext, wurden aber an anderer Stelle abgelegt. Danach war am 13. Januar um eine Beurteilung Zenders gebeten worden. Dieser habe von 1927 bis zu ihrer Auflösung der Unitas angehört. Vor 1933 sei er Mitglied keiner Partei gewesen. Dem „ND“ gehöre er nicht an, unterstütze ihn aber. Damit ist vermutlich der Bund Neudeutschland gemeint, eine katholische Jugendorganisation, der auch sein Bruder Nikla angehörte [43]. Seit dem 15.3.1938 sei er Parteianwärter, seit Oktober 1933 gehöre er dem NSLB und der NSV an. Zender verfüge über „ein reiches und gründliches Wissen“ und habe sich an der „grenzlanddeutschen Arbeitsgemeinschaft“ beteiligt. „Weltanschaulich aber bewegt er sich völlig im Fahrwasser des Katholizismus und wird sich wohl niemals von seinen katholischen Bindungen lossagen können.“
Zenders Habilitation, sollte vereitelt werden, wobei der Hauptvorwurf war, dass er sich „völlig im Fahrwasser des Katholizismus“ bewege. Dies galt für die ganze Abteilung Sprache und Volkskunde am Bonner Institut für geschichtliche Landeskunde [44]. Die heftige Reaktion hinter den Kulissen hatte wohl verschiedene Ursachen: Zunächst gab es seit 1938 intensive Planungen zur Gründung eines volkskundlichen Instituts, wobei sich die Beteiligten darüber einig waren, dass hierfür eine Persönlichkeit gefunden werden müsse, die „weltanschaulich und wissenschaftlich gleich zuverlässig sei.“ Und die, war man sich schon vorher einig, sei in Bonn nicht zu finden [45]. Das Institut sollte eine eigene Abteilung für „Erzählgut, Sagen und Märchen, die aus dem Institut für Geschichtliche Landeskunde herauszunehmen wären,“ erhalten. Zenders Person war hier nicht vorgesehen, sein Habilitationsvorhaben brachte das Kandidatenkarussell ins Schlingern. Auch inhaltlich dürfte sein Projekt für Befremden gesorgt haben: Zender wollte auf seine eigene, vollkommen unpolitische Art und Weise ein hochbrisantes Thema bearbeiten. Ob er unbedarft, uninformiert oder einfach nur vertrauensselig war, sei dahingestellt. Hinzu kommt aber noch ein drittes Konfliktfeld: 1936 war in Berlin beim Atlas der deutschen Volkskunde ein „Zentralarchiv der deutschen Volkserzählung“ gegründet worden. 1938 wurde das Archiv als „Lehr- und Forschungsstätte für Volkserzählung, Märchen- und Sagenkunde“ dem Ahnenerbe eingegliedert – hier sah man in Zenders Forschungsvorhaben womöglich eine unerwünschte Konkurrenz [46].
Zender hatte im Übrigen bis dahin auch kein enges, aber doch ein unproblematisches Verhältnis zum VDA. Die Vorarbeiten zu seiner Habilitationsschrift wurden von 1936 bis 1938 finanziell gefördert [47]. 1939 wurde eine Exkursion Bonner Studenten ins westliche Grenzland unterstützt und Zender leistete Schützenhilfe für den Entwurf eines Flugblattes des Bundes der Deutsch-Belgier zur Einweihung eines Denkmals für den 1916 gestorbenen Historiker Gottfried Kurth in Arlon [48]. Mehrfach hat er auch für die Bundesleitung des VDA Buchmanuskripte und Periodika begutachtet, ob sie für einen Druck oder einen Versand nach „Deutschbelgien“ in Frage kämen. Auch seine eigenen Publikationen wurden unterstützt [49]. Bereits 1938 fand eine Besprechung mit Studienassessor Dr. Güllecke statt, wie man das Deutschtum in Arlon fördern könne [50]. Aus der Korrespondenz geht weiter hervor, dass sich Zender häufig nicht in Bonn aufhielt. Im August und September 1938 weilte er für „volkskundliche Aufnahmen“ in Belgien und Luxemburg, im November 1938 in Arlon und im November 1939 in Luxemburg. Die Reisen dürften vom VDA bezuschusst worden sein [51].

Franz Petri, Porträtfoto, um 1961. (Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland)
Bemerkenswert ist jedenfalls, dass Steinbach, das Institut und die Fakultät trotzdem an Zender festhielten; wenige Tage später, am 1.4.1939, wurde dieser zum Assistenten ernannt. Als Zenders Vertrag 1941 auslief, beantragte Steinbach eine Verlängerung, die er mit seinen Aufsätzen und Vorträgen begründete. „Seine Habilitationsarbeit über ‚Beziehungen zwischen der Verbreitung des volkstümlichen Erzählgutes und der germanischen-romanischen Sprachgrenze‘ konnte wegen seiner am 7.11.1939 erfolgten Einberufung noch nicht abgeschlossen werden.“ Es sei mit Sicherheit zu erwarten, dass er damit eine Dozentur erlangen werde [52]. Ein ähnliches Schreiben richtete Bach am 5.12.1941 an die Fakultät, aus einem Randvermerk ist eine Weiterbeschäftigung bis 1943 ersichtlich [53]. 1943 erfolgte eine weitere Verlängerung [54].
2.3 Kriegsverwaltungsrat in Arlon
Bereits am 1.11.1939 wurde Zender zur Wehrmacht einberufen, aber kurz danach wieder entlassen. Am 20.5.1940 wurde er nochmals einberufen und tat in Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern) Dienst als Soldat. 1940 und 1941 hielt er sich mehrfach in Belgien und Luxemburg auf; er war dort als Sachbearbeiter für Volkstumsfragen für die Außenstelle West des VDA tätig [55]. Am 1.4.1941 wurde er zum Kriegsverwaltungsrat in Arlon ernannt. Seine Aufgabe war die eines Referenten für Sprachfragen bei der deutschen Kommandantur. Inwieweit bei seiner Berufung Kriegsverwaltungsrat Franz Petri, der seit 1940 als Kulturreferent bei der Militärverwaltung in Belgien und Nordfrankreich tätig war, eine Rolle spielte, kann hier nicht weiter untersucht werden [56]. Zender war in Arlon für den deutschsprachigen Unterricht sowie die Pflege der deutschen Sprache und Kultur zuständig. Ab dem 1.9.1944 war er wiederum an unbekannter Stelle Soldat, zunächst in einer Ausbildungskompagnie, nach drei Monaten dann an der Front. Am 14.4.1945 geriet er in amerikanische Gefangenschaft, wurde aber schon am 12. Juli entlassen. Er trat seinen Dienst am Institut wieder an, wurde aber am 28.1.1946, nachdem die Belgier ein Auslieferungsansuchen gestellt hatten, verhaftet, nach Belgien überstellt und dort bis zum 28.9.1949 festgehalten [57]. Mit einer „ordonnance de non-lieu“, einer Verfahrenseinstellung aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Gründen, endete die Untersuchungshaft, ohne dass Anklage erhoben worden wäre. Ermittelt wurde wegen des Vorwurfs, Zender habe die Annexion des Gebietes um Arlon betrieben, wozu er in einer ausführlichen Rechtfertigungsschrift Stellung bezog [58].
2.3.1 Elf Zeugnisse zu Zenders Entlastung
Über Zenders Tätigkeit in Arlon hat kürzlich Carlo Lejeune eine umfangreiche Publikation vorgelegt, die sowohl die umfangreiche Ermittlungsakte als auch Zenders persönlichen Nachlass auswertet [59]. Deshalb soll hier nur ein Aspekt aufgegriffen werden: Zwischen dem 14.8.1947 und dem 16.1.1948 (beziehungsweise dem 4.7.1949) entstanden elf Erklärungen, in denen Zender bekannte Personen ein Zeugnis über sein Verhältnis zum Dritten Reich” ausstellten [60]. Auch wenn die Quellengruppe dieser Bescheinigungen, oft „Persilscheine“ genannt, nicht unproblematisch ist, erlaubt sie doch eine ganze Reihe von Hinweisen auf Zenders persönliches Umfeld.
Den Auftakt machte am 14.8.1947 Franz Steinbach mit einer eidesstattlichen Erklärung. „Dr. Zenders religiöse und politische Überzeugungen waren schon vor 1933 so gefestigt, dass er niemals in Gefahr kommen konnte, ein ‚Nazi‘ zu werden.“ Nach 1933 seien er und seine Arbeit misstrauisch beobachtet und angegriffen worden. „Der äusserliche Beitritt zur Partei war […] unvermeidbar, wenn er nicht auf die erhoffte wissenschaftliche Laufbahn von vorneherein verzichten wollte.“ Seine Beschäftigung mit der Sprachgrenze und seine Forschungen über Arlon seien ausschließlich „aus wissenschaftlichen und persönlichen Motiven“ hervorgegangen und hätten nichts mit Politik zu tun gehabt. Danach habe er seine Hauptaufgabe „im Schutz der Bevölkerung gegen parteipolitische und bürokratische Missgriffe“ gesehen. Steinbach unterstreicht zum Abschluss: „Ich versichere, dass ich zu keiner Zeit Mitglied der Partei gewesen bin.“
Vier Tage später folgte am 18.8.1947 Zenders Lehrer und Mentor Adolf Bach, der nach dem Verlust seines Straßburger Lehrstuhls seine Bonner Privatadresse angab [61]. Zender sei nur gezwungenermaßen (von Bach überredet?), widerstrebend und unter schweren Gewissensbissen in die NSDAP eingetreten, habe als praktizierender Katholik keinerlei Beziehung zu deren Ideologie besessen, was sich auch in seiner wissenschaftlichen Arbeit niedergeschlagen habe. Dass Zender von Bach trotz dessen politischer Vergangenheit ein Zeugnis vorlegte, erscheint befremdlich, ist aber durch die große Verehrung gegenüber dem Lehrer erklärbar.
Ein ergreifendes Schreiben stammt von Edith Ennen, die seit 1930 Studienkollegin Zenders war. Sie promovierte 1932 bei Steinbach, wurde 1935 nach ihrem Examen für den höheren Archivdienst im Bonner Institut „wissenschaftliche Hilfsarbeiterin“, vertrat Zenders Stelle im Krieg und war 1945/1946 seine Assistentenkollegin. Ennen hob am 18. August Zenders „innere Gegnerschaft zum Nationalsozialismus“ hervor und betonte die christliche Tradition seines Elternhauses. Er habe der Zentrumspartei nahe gestanden und „lebhafte Sympathien für Brüning“ empfunden [62]. Zender sei ausschließlich „aus Sorge um sein berufliches Fortkommen“ 1937 der Partei beigetreten, habe sich aber von allen Veranstaltungen ferngehalten. Seine ablehnende Einstellung sei bemerkt worden und er habe deshalb „berufliche Schwierigkeiten“ gehabt. Ein Stipendium sei abgelehnt worden, weil er „konfessionell gebunden“ gewesen sei. Zenders Einstellung als Assistent stellte in den Augen der Gestapo und des NSD-Studentenbundes eine erhebliche Belastung für das Institut dar. Auch in Arlon habe es öfters Zusammenstöße mit Vertretern von Parteiorganisationen gegeben. Zender sei ein „gütiger und hilfsbereiter Mensch“, habe einen „tiefeingewurzelten Sinn für Humanität und Toleranz“, wie es die „Gebote des Christentums und der Menschlichkeit“ verlangen. Sie selbst sei aus religiösen Gründen kein Mitglied der Partei oder einer sonstigen Organisation gewesen.
Ein viertes Gutachten aus dem Bonner Institut stammt von dem politisch ebenfalls unverdächtigen Karl Meisen. Zender sei ein guter Katholik, ein „stiller, fleissiger Gelehrter“, aber „nie Nationalsozialist“ gewesen. Er selbst sei wegen seiner politischen Haltung seines Amts enthoben worden, und er hätte nach seiner Wiedereinsetzung keinen Assistenten eingestellt, der der NS-Ideologie nahe gestanden habe.
Mit erheblichem zeitlichen Abstand folgte am 4.7.1949 eine Erklärung von Franz Petri, der nach dem Krieg seinen Kölner Lehrstuhl verloren hatte und inhaftiert worden war. Nachdem er zahlreiche Zeugnisse deutscher, belgischer und holländischer Kollegen vorgelegt hatte, wurde er erst als „Mitläufer“, dann als „Entlasteter“ eingestuft, ohne freilich seinen Lehrstuhl zurückzuerhalten. Nach einer Tätigkeit als Nachhilfelehrer erhielt er 1948 vom Rheinischen Landesmuseum in Bonn einen Werkvertrag zur Aufarbeitung von „Schriftquellen zum frühgeschichtlichen Befestigungswesen“ und 1949 vom Bonner Institut einen weiteren über „Die landschaftliche Zusammenhänge in den Gebieten der Eifel, des Mittelrheins und des Westerwaldes.“ Danach gründete er die Arbeitsgemeinschaft für westdeutsche Landes- und Volksforschung, die die Arbeit der Westdeutschen Forschungsgemeinschaft fortsetzen sollte. Ihr Leiter war Steinbach, Petri wurde Schriftführer und finanziert wurde das Ganze vom Bundesministerium für Gesamtdeutsche Fragen, wo Petris ehemaliger Brüsseler Vorgesetzter, Franz Thedieck (1900-1995), Staatssekretär war [63]. 1951 wurde Petri Direktor des Provinzialinstituts für westfälische Landes- und Volkskunde in Münster, und 1961 gelang es Steinbach, ihn als seinen Nachfolger auf den Lehrstuhl für rheinische Landesgeschichte und als Direktor des Instituts für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande nach Bonn berufen zu lassen [64]. Für fünf Jahre war er somit Kollege von Matthias Zender. Erst nach seiner Emeritierung 1968 gelang es, Edith Ennen auf den Steinbach-Lehrstuhl zu berufen.
Petris umfangreiches Zeugnis berichtet, dass er ihn bereits als Assistenten gekannt habe und dass er im Krieg in Brüssel über Zenders Tätigkeit in Arlon gut informiert gewesen sei. Im Auftrag der Militärverwaltung habe er „das Übergreifen der von der Luxemburger Zivilverwaltung und der volksdeutschen Bewegung Luxemburg entfachten Anschlusspropaganda“ entgegengewirkt. Ausführlich wird aus einem Schreiben des Chefs der Militärverwaltung an Gauleiter Gustav Simon zitiert, auch seine schriftliche Instruktion wird wiedergegeben. Zender sei in erster Linie Wissenschaftler gewesen, es handle sich um einen „lauteren, religiös fest in seinem katholischen Glauben verwurzelten Menschen.“
Drei weitere Bescheinigungen stammen aus dem Trierer Priesterseminar. Professor Dr. Ignaz Backes (1899-1979) stand mit Zender seit 1931 in freundschaftlicher Verbindung. Er bezeugte am 27. August, Zender sei ein „kluger Gegner“ der Partei gewesen, habe in seiner Volkstumsforschung die Irrtümer der NS-Ideologie widerlegt und den Militarismus sowie die außenpolitische Expansion abgelehnt. Am 1. September bescheinigte Josef Hansen (1903-1975), Direktor des Bischöflichen Konvikts in Trier, dass er Zender seit 25 Jahren kenne [1922] und mit ihm während seines Studiums in Bonn (1932-1937) viel zusammen gewesen sei. Als treuer Katholik habe er Parteimitglied werden müssen, da sonst ein Abschluss seiner Studien nicht möglich gewesen sei [65]. Das dritte Zeugnis stammt von Professor Dr. Wilhelm Bartz (1901-1983), der am 12. Oktober schrieb, dass er Zender seit seiner Zeit im Bischöflichen Konvikt und am Gymnasium in Trier sowie aus seiner Studentenzeit in Bonn (1931-1936) kenne. Zender und seine Frau seien entschiedene Gegner des Nationalsozialismus gewesen, bei ihnen habe er stets „die neuesten Gegenschriften gegen die NSDAP“ einsehen können. In seinen Forschungen sei er „mutig und klug dem nationalsozialistischen Ungeist und Kirchenhass entgegen“ getreten, habe sich damit jedoch „glänzende Aufstiegsmöglichkeiten“ verbaut [66].
Der aus dem Saarland stammende Ignaz Backes hatte in Trier, München und Bonn studiert, bevor er 1935 als Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an das Trierer Priesterseminar berufen wurde, das 1950 zur Theologischen Fakultät, umgewandelt wurde. Neben zahlreichen Veröffentlichungen über Thomas von Aquin (um 1225-1274), Albertus Magnus, Ulrich von Straßburg (gestorben 1277), Nikolaus Cusanus und Hieronymus Jaegen (1841-1919) ist seine Mitwirkung am Zweiten Vatikanischen Konzil hervorzuheben [67]. Wilhelm Bartz wurde 1901 in Wettlingen bei Bitburg, also unweit von Niederweis, geboren und besuchte die Volksschule im benachbarten Bettingen, bevor er das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier absolvierte. Ab 1921 studierte er in Trier Theologie, nach einer Tätigkeit als Lehrer von 1931 bis 1935 Theologie, Geschichte und Philosophie in Bonn. Danach war er Lehrer und Standortpfarrer in Bitburg, wo seine Arbeit von der NSDAP erheblich behindert wurde. Nachdem er bereits 1939 promoviert worden war und sich 1946 in Trier habilitierte, wurde er 1947 zum Professor für Fundamentaltheologie ernannt. Zudem war er ständiger Berater der Deutschen Bischofskonferenz in Fragen der Ökumene [68]. Zender besuchte seit 1919 das Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Wilhelm Bartz seit 1921 und der spätere Regens des Priesterseminars und Domkapitular Josef Hansen (1903-1975) seit 1923 [69].
Zwei der Zeugnisaussteller waren also Schulkollegen Zenders, zwei zudem Kommilitonen. Alle drei sind dem katholischen Milieu zuzuordnen, in dem Zender somit noch viel stärker verwurzelt war, als bisher angenommen. Unter den Professoren der Trierer Universität findet sich 1947 nicht nur der spätere Bischof Matthias Wehr (1892-1967, Bischof von Trier 1951-1966), sondern auch ein weiterer Schulkamerad Zenders, der spätere Kölner Kardinal Joseph Höffner.
Drei weitere, recht ausführliche Zeugnisse stammen aus einem dritten Kreis von Personen. Am 30.10.1947 schrieb „Dr. Eugen Löffler (1883-1979), Ministerialrat im Kultusministerium“, er sei von 1941 bis 1944 „Sachbearbeiter für Schulfragen“ beim Chef der Militärverwaltung in Belgien gewesen [70]. Zender habe stets den Gesetzen entsprechend gehandelt und die von verschiedenen deutschen Stellen betriebenen separatistischen Tendenzen bekämpft. Er sei „loyal gegen sein Vaterland, korrekt und human gegen die Bevölkerung“ gewesen.
Oberregierungsrat Franz Thedieck gab ab 1.1.1948 in Hennef an der Sieg eine umfangreiche eidesstattliche Erklärung ab. Er war als Oberverwaltungsrat bei der Militärverwaltung in Brüssel tätig gewesen und 1943 wegen seiner politischen Einstellung auf persönliche Anordnung des Reichsführers SS entfernt worden. Er rechnete sich zum Widerstand im Umfeld von Jakob Kaiser (1888-1961) und Carl Friedrich Goerdeler (1884-1945). Zender und seine Forschungsarbeit über die Sagen und Märchen der Grenzgebiete kenne er bereits aus dessen Assistentenzeit in Bonn. Zender habe „die totalitäre Herrschaftsform, Antisemitismus, Rassendünkel, Religionsfeindlichkeit“ verabscheut. Was Thedieck sagte, dürfte alles wahr sein, aber er sagte nicht alles, was wahr ist: Er war von 1923 bis 1930 stellvertretender Leiter der Preußischen Abwehrstelle für die besetzten Gebiete im Rheinland, die den Separatismus bekämpfen sollte, wurde 1931 Regierungsrat und war ab 1933 für die Unterstützung der deutschen Vereine in Eupen-Malmedy zuständig, eine durchaus subversive Tätigkeit. Gleichzeitig war er für den Verein für das Deutschtum im Ausland, Bezirksreferat Mittelrhein tätig, mit dem ja auch Zender zusammenarbeitete. Im Krieg war er „Flamenreferent“ in Brüssel. In Anlehnung an Schöttler und Tiedau kann man von einer „Runde“ beziehungsweise „Stunde der Experten“ sprechen: Eggert Reeder (1894-1959) war unter General Alexander von Falkenhausen (1878-1966) Chef der Militärverwaltung, Thedieck dessen Generalreferent, Petri und Resse waren unter Löffler als Leiter der Kulturabteilung Referenten für Volkstum, Kultur und Wissenschaft [71].
Wegen seiner katholischen Haltung wurde Thedieck zur Wehrmacht versetzt. Trotz einer Verurteilung wegen eines gefälschten Fragebogens 1946 wurde er Oberregierungsrat in Köln. Als Staatssekretär im Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen förderte er ab 1950 die von Steinbach begründete Arbeitsgemeinschaft für westdeutsche Landes- und Volksforschung [72]. Schließlich war er für die Konrad-Adenauer-Stiftung tätig und wurde 1966 Intendant des Deutschlandfunks [73].
Auf Thediecks Zeugnis bezieht sich ein Dankschreiben Zenders vom 14.10.1949. Zender bedankt sich nach seiner Entlassung „für die warme Anteilnahme“ und „für das energische und eindrucksvolle Gutachten, das meine Frau 1947 von Ihnen erhielt. Ihr Gutachten trug wesentlich dazu bei, die allgemeine Atmosphäre in meinem Fall zu ändern.“ Zender erklärt sich bereit, Thedieck, der in den Jahren nach dem Krieg eine Art Anlaufstelle für die ehemaligen Mitarbeiter der Militärverwaltung in Brüssel war, über die neuere Lage in Belgien zu unterrichten. Weiter berichtet er, er habe seine „unfreiwillige Muße“ für eine Beschäftigung mit Fragen der französischen Kulturgeschichte genutzt [74].
Ein letztes Testat stammt vom 16.1.1948. Oberregierungsrat Dr. Wolfgang Streit (1904-1969) war als „Sachbearbeiter für Angelegenheiten der allgemeinen Verwaltung“ ein Kollege Zenders in Arlon. Dieser habe sich für die belgische Bevölkerung eingesetzt und den separatistischen Bestrebungen der in Luxemburg tätigen Parteifunktionäre entgegengewirkt. Zender sei „ein Mann der Wissenschaft und überdies ein betonter Katholik [75].
Es gibt also insgesamt elf Testate, di e innerhalb von fünf Monaten Ende 1947 und Anfang 1948 beziehungsweise 1949 entstanden. Drei von ihnen stammen aus dem Trierer Priesterseminar, von Kollegen aus Zenders Schul- und Studienzeit, fünf aus dem Bonner Institut und drei von Kollegen, die im Krieg in Arlon und Brüssel tätig waren. Ob es taktisch geschickt war, sie um ein Zeugnis zu bitten, das den belgischen Behörden vorgelegt werden sollte, sei dahingestellt, auch über die Entscheidung für Adolf Bach wundert man sich. Auch das nachträglich vorgelegte Testat Franz Petris befremdet. In jedem Fall werfen die drei Zeugnisse ein interessantes Licht auf Zenders Beziehungen nach Trier, auf seine Verwurzelung im katholischen Milieu und sein Netzwerk in Arlon. Genutzt haben sie freilich wenig; Zender blieb bis 1949 in Untersuchungshaft. Daran änderte auch ein Schreiben des belgischen Mundartenforschers Professor Henri Draye (1911-1983) an das Justizministerium von 1949 nichts, der sich ebenfalls für Zender einsetzte [76]. Draye war 1937 als Student nach Bonn gekommen. Die Westdeutsche Forschungsgemeinschaft förderte seinen Aufenthalt mit einem großzügigen Stipendium. Bereits 1937 referierte er auf der Tagung in Aachen und 1938 veröffentlichte er zwei Sammelberichte über siedlungsgeschichtliche Arbeiten in den südlichen Niederlanden [77]. Er war eng mit Ennen, Textor und Zender befreundet, worauf die erhaltene Korrespondenz der Jahre 1939 bis 1942 hinweist [78].
Bereits am 8.3.1948 meldete sich Draye wieder bei Steinbach und dankte für die vielen Anregungen, die er in seiner Bonner Zeit erhalten hatte. Er berichtet ausführlich von den Schwierigkeiten nach Kriegsende, er sei allerdings 1946 zum Ordinarius für Deutsche Philologie und Literaturgeschichte des Mittelalters in Löwen ernannt worden. Es sei noch zu früh, die alten Beziehungen wieder aufzunehmen, aber er freue sich auf das Wiedererscheinen der Vierteljahrsblätter. Er habe sich „an den Advokaten (!) Herrn Zenders in Arlon“ gewandt, der sich allerdings nicht melde. Franz Petri habe bessere Chancen, für ihn habe er ein Zeugnis besorgt [79]. Am 1. April antwortete Steinbach, nach allerhand Nachrichten schreibt er: „Unsere größte Sorge haben wir immer noch um Herrn Zender. Seine Frau schreibt mir eben, dass Anklage gegen ihn erhoben sei: détournement des institutions d‘état belge. Was damit gemeint sein soll, ist mir völlig unklar. Versuchen Sie doch bitte alles, was in Ihrer Kraft steht, zu helfen.“ Zender habe sein Schicksal am allerwenigsten verdient, man vermisse ihn auch als Bearbeiter des Rheinischen Wörterbuchs. Um Petri mache er sich weniger Sorge, er besitze „viel Lebenskraft und Energie […]. Zender ist viel weicher und auch körperlich weniger fest.“
Am 9.7.1948 kann Draye freudig einen Besuch in Köln und Bonn ankündigen [80]. 1949 referierte er auf der Jahreshauptversammlung des Vereins für geschichtliche Landeskunde über die Kooperationsmöglichkeiten von Archäologie und Sprachgeschichte bei der Ortsnamensforschung im nordwesteuropäischen Kontext [81]. 1956 publizierte er in den Vierteljahrsblättern einen Aufsatz über Ortsnamen und Sprachgrenzen in Belgien und 1966 referierte er auf der Arbeitstagung über die literarische Vermittlungsfunktion Flanderns im Mittelalter [82]. Kontinuitäten bei der „Westforschung gab es also nicht nur im Rheinland.“
2.3.2 Die deutsche Sprachinsel um Arlon
Im Raum Arlon gab es eine große deutschsprachige Minderheit. Das Gebiet, in den 1920er Jahren im Gegensatz zu Eupen-Malmedy (Neu-Deutsch-Belgien) als „Alt-Deutsch-Belgien“ bezeichnet, umschloss 312 Quadratkilometer mit 73 Ortschaften und 41.000 Einwohnern, von denen 33.000 deutschsprachig waren. Sie wurde in der Region, in Deutschland und in Belgien sehr unterschiedlich wahrgenommen: In Arlon verstand man sich überwiegend als belgische Staatsangehörige mit deutscher Sprache. In Belgien erinnerte man sich dagegen an die Gräuel des Ersten Weltkrieges, sah in der Nichtverwendung der französischen Sprache eine unpatriotische Parteinahme und vermutete in den deutschsprachigen Belgiern potentielle Kollaborateure im nächsten Krieg. Auf deutscher Seite sah man in ihnen dagegen unterdrückte Landsleute, kritisierte die „Verwelschung“ und träumte von einer „Wiedereindeutschung“. Matthias Zender dagegen war von der Sprache und Kultur der Region begeistert, die ihn auch in ihrer Altertümlichkeit an seine Eifelheimat erinnerte.

Franz Steinbach, Porträtfoto. (Universitätsarchiv Bonn)
Die Militärverwaltung tat im besetzten Belgien alles, um Konflikte mit der einheimischen Bevölkerung zu vermeiden. Anders als in Luxemburg und in Eupen-Malmedy wurden Eingriffe von NS-Organisationen wie SS und SD behindert sowie Diskussionen um Annexionen in der Nachkriegsordnung vermieden [83] . Insofern hat man die deutsche Sprache und Kultur zwar gefördert, jedoch alles getan, um eine Identifizierung mit den neuen Machthabern zu vermeiden. Lejeune kommt zu einer sehr differenzierten Antwort auf die Fragen „War Zender ein Nazi?“, war er „Teil des Unterdrückungsapparates oder geradliniger Humanist?“ Er stellt fest, dass Zender zu Unrecht als Repräsentant, als Gallionsfigur des verhassten Regimes angesehen wurde, und dass sich auch die Maßstäbe der belgischen Gerichte in der Nachkriegszeit verändert hatten, bis der Kassationshof 1949 feststellte, dass die Vertretung deutscher Interessen allein noch keine Straftat sei.
2.3.3 Arlon und Zenders Arbeiten zur Grenzlandforschung vor 1939
Bevor wir auf Zenders wissenschaftliche Arbeiten zu sprechen kommen, muss vorausgeschickt werden, dass die „Grenzlandforschung“ seit 1928 ein wichtiger Forschungsschwerpunkt des Bonner Instituts war. Zahlreiche Projekte, Veröffentlichungen, Seminare und Exkursionen befassten sich mit dem Saarland, Luxemburg und dem belgischen Ostgebiet um St. Vith, Eupen und Malmedy. Mit dieser Region beschäftigte sich Zender bereits bei der Materialsammlung für seine Dissertation und wohl auch schon bei den Vorarbeiten für die geplante Habilitation. So veröffentlichte er 1936 einen kleinen Aufsatz über Sagen aus der Gegend von St. Vith, Eupen und Malmedy [84].

'Familie H.-W. aus Post bei Arrel'. (Zender, Quellen und Träger, 1937)
Im gleichen Jahr hielt er auf dem Deutschen Volkskundetag in Bremen einen Vortrag, der 1937 unter dem Titel „Quellen und Träger der deutschen Volkserzählung“ gedruckt wurde. In dem Aufsatz spielen Erzähler aus dem Raum um Arlon, von denen mehrere abgebildet werden, eine große Rolle [85] . 1937 erschien auch in der Reihe „Deutsches Grenzvolk im Westen erzählt“ sein Buch „In Eifel und Ardennen.“
Bereits 1939 veröffentlichte Zender eine gewichtige Abhandlung über „die deutsche Sprache in der Gegend von Arel“ (85). Bei der umfangreichen Untersuchung, die die Größenordnung und Qualität einer Dissertation erreichte, handelte es sich womöglich um ein größeres Kapitel aus der geplanten Habilitationsschrift (86). Dem Aufsatz ist eine dreiseitige „landeskundliche Vorbemerkung“ des auch in Bonn im Bereich der „Westforschung“ tätigen Geographen Josef Schmithüsen (1909-1984), der 1934 über das rheinische Schiefergebirge promoviert hatte und danach mit der Arbeit an seinem Buch „Das Luxemburger Land – Landesnatur, Volkstum und bäuerliche Wirtschaft“ (1940) begann, vorangestellt (87). Schmithüsen war danach in ähnlichen Funktionen wie Zender in Arlon in Luxemburg tätig (88), wo der berüchtigte Gauleiter Gustav Simon eine massive Regermanisierungspoltik versuchte, die auch nach Arlon ausstrahlte (89).
Zenders Arbeit basierte auf umfangreichen Literaturstudien und zahlreichen Forschungsaufenthalten, bei denen er die Bevölkerung befragte. Sie zeigten einen „stillen, aber zähen Abwehrkampf gegen die Verwelschung.“ Der Verfasser analysierte Sprachenkarten, Familien- und Flurnamen, aber auch Grabsteine und Totenzettel, um die „Umvolkung“ in Form von Bevölkerungs- und Sprachverschiebungen nachzuweisen. Die Rolle der Verwaltungsgeschichte wurde dabei ebenso berücksichtigt wie die der wirtschaftlichen Entwicklung, der Verwaltung, der Schulen, der Kirche und der Presse. Ausführlich schilderte Zender die Rolle des „Deutschen Vereins zur Hebung und Pflege der Muttersprache im deutschredenden Belgien“ vor dem Ersten Weltkrieg. Dann kamen „Siegestaumel und Chauvinismus der Nachkriegszeit“, die deutsche Sprache verschwand aus Schulen, Kirchen und Behörden. Die belgischen Darstellungen dieser Phänomene werden ebenso kritisiert wie die amtliche Sprachstatistik von 1930, der Zender seine Beobachtungen über die Verbreitung und Funktion der Mundart gegenüber stellt.

'Bauer P. aus Thommen b. St. Vith'. (Zender, Quellen und Träger, 1937)
„Der bodenständige, in unserem Falle also deutsche, Teil einer Stadtbevölkerung gibt der Stadt immer das eigentliche Gepräge, selbst wenn die Zahl kleiner ist als die der Fremden.“ Im Bauerntum sah er einen Garanten für den Fortbestand der deutschen Sprache und Kultur. Freilich müsse es auch möglich sein, „reichsdeutsche“ Zeitungen und Bücher zu kaufen, was selbst am Bahnhof nicht möglich sei. Das Radio schaffe jetzt neue Möglichkeiten (90). Politisch seien „die Deutschen von Arel“ allerdings „betont belgisch“, treue Untertanen des Königs und froh, dass nach dem Krieg wieder Ruhe eingekehrt sei. Die politische Zugehörigkeit der Region zu Belgien stellt Zender also nicht in Frage. Er vertraut auf die Selbstheilungskraft der Tradition: „Das deutsche Volkstum um Arel wird aus sich selbst gesunden.“
2.3.4 Zenders Arbeiten über Arlon nach 1941
Der Krieg beeinträchtigte die wissenschaftliche Arbeit Zenders, führte aber auch zu neuen Projekten (91). Er stand die ganze Zeit über in engem Briefkontakt mit Edith Ennen, die den Institutsbetrieb in Bonn aufrechterhielt, bis 1942 die Vierteljahrsblätter redigierte und Zender über Neuigkeiten informierte (92). 1940 erschienen noch vier und 1941 drei Arbeiten aus seiner Feder. Die meisten standen mit seiner neuen Tätigkeit in Verbindung. 1940 publizierte er über ein Märchen aus der Gegend um Arel und über das Sagengut des Kreises Malmedy, 1941 über den „deutschen Dichter“ Peter Klein (1825-1855) in Luxemburg, der 1855 ein Buch über „die Sprache der Luxemburger“ verfasst hatte und sich gegen die französischen Einflüsse zur Wehr setzte, und über den „deutschen Kämpfer“ Nikolaus Warker, der wegen seines Eintretens für eine Germanisierung in Arlon nach dem Ersten Weltkrieg aus dem Schuldienst entfernt worden war.

'K. aus Hünningen bei St. Vith'. (Zender, Quellen und Träger, 1937)
Eine Schrift Zenders ist besonders hervorzuheben: Da der Vorlesungsbetrieb durch den Krieg gestört war, wurden von 1939 bis 1944 an der Universität Bonn knapp 160 „Kriegsvorträge“ gehalten. Namhafte Referenten von der Hochschule, aber auch aus NS-Organisationen und Wehrmacht referierten über Themen von allgemeinem Interesse, die mehr oder minder propagandistisch ausgerichtet waren; sie wurden später als kleine Hefte gedruckt (93). 1942 sprach „Dr. M. Zender, Mitglied des NSD-Dozentenbundes“ über den „Sprachenkampf im volksdeutschen Gebiet um Arel“ (94). Der Leser stolpert zunächst über den martialischen Titel und Begriffe wie „Verwelschung“ oder „Umvolkung“, die wir heute in engem Zusammenhang mit der NS-Ideologie sehen. Es kann sein, dass sie damals zur Alltags- beziehungsweise zur Wissenschaftssprache der „Westforschung“ gehört haben. Es wäre aber auch denkbar, dass Zender sie absichtlich benutzt hat: Linientreue Leser erkannten sie wieder und konnten den Eindruck gewinnen, der ansonsten weitgehend unpolitische Text bekenne sich damit zur Linie der NSDAP (95).
Doch abgesehen von dem Titel und einigen Begriffen stellt der Vortrag eine brillante Analyse des Verhältnisses von deutscher und französischer Sprache im Gebiet um Arlon dar. Man erkennt darin die breite humanistische Bildung, wie er den Bogen von der Einführung der französischen Amtssprache durch die Burgunderherzöge im 15. über die Einwanderung wallonischer Eisenarbeiter im 18. Jahrhundert zur territorialen Zuordnung der Region nach Luxemburg und dann nach Belgien spannte.

'Bauer D. aus Mont-Xhoffraix bei Malmedy'. (Zender, Quellen und Träger, 1937)
Im 19. Jahrhundert galt Französisch als Sprache der feinen Leute. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Deutsch als „Sprache des Feindes“ angesehen und zunehmend aus den Schulen und aus der Verwaltung verdrängt. Ab 1930 war Deutschunterricht an den Schulen wieder zugelassen. 1931 wurde als Interessenvertretung ein „Bund der Deutschbelgier“ ins Leben gerufen. Die Entwicklung nach 1939 wird nicht weiter angesprochen, der Vortrag endet mit einem Lob für eine tapfere Volksgruppe, die „mit der Erhaltung ihrer deutschen Muttersprache die Grundlage ihres Volkstums bewahrt und damit für eine spätere gesunde Entwicklung des deutschen Volkstums in Arel die notwendigen Voraussetzungen geschaffen“ hat. Mit dieser Schrift konnte sich Zender auch nach 1945 noch sehen lassen. Wir lernen hier eine seiner Charaktereigenschaften kennen: Er war ein begeisterter Historiker und Volkskundler, der seine Heimat – wozu er auch Deutschbelgien zählte – innig liebte. Aber er war kein Politiker, und er wollte diesen auch keine Ratschläge geben. Deshalb lieferte er eine einfühlsame und fundierte Analyse, die eine ausgeprägte Sympathie für seine neue Heimat erkennen lässt, er warb für Verständnis, stellte aber keine konkreten Forderungen.
Hinzuweisen bleibt noch auf eine Abhandlung Zenders über „die Binnenwanderung Belgiens in völkischer Sicht“, in der es um das Verhältnis von Flamen und Wallonen, um Wanderungsbewegungen und Geburtenüberschuss geht; auch hier spielt der Raum Arlon eine besondere Rolle (96). Von da an klafft in seinem Schriftenverzeichnis eine Lücke bis zum Jahre 1950 (97). Bei dem Areler Heimatkalender, der 1943 und 1944 vom Deutschen Sprachverein herausgegeben wurde, trat Zender als Autor nicht in Erscheinung (98).
2.3.5 Der Eifelverein und „Neu-Deutsch-Belgien“
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass im deutschsprachigen Belgien auch der Eifelverein keine ruhmvolle Rolle spielte (99). In Malmedy war bereits 1888 und in Eupen 1893 eine Ortsgruppe gegründet worden. Bis 1913 gab es allein im Kreis Malmedy elf Ortsgruppen, und 1933 zählte man in Eupen-Malmedy sechs Ortsgruppen mit rund 730 Mitgliedern (100). Sie hatten ihre Arbeit als Wander- und Kulturvereine fortgesetzt und ihre Verbindungen zu den Ortsgruppen in Deutschland und zum Hauptverein aufrechterhalten.

'Bauer D. aus Oviat bei Malmedy'. (Zender, Quellen und Träger, 1937)
1933 wurde der Eifelverein problemlos gleichgeschaltet, seine Veranstaltungen und Periodika hat man kurzerhand zu Foren der nationalsozialistischen Propaganda umfunktioniert. Bereits 1933 wurde bei einer Veranstaltung in Dortmund die Rückkehr des „uralten deutschen Landes […] mit fast rein deutscher Bevölkerung“ in Eupen-Malmedy gefordert, und 1934 hatte der Vorsitzende Karl Leopold Kaufmann, der vor dem Krieg Landrat in Malmedy war, die „Förderung des Deutschtums in der Westmark“ durch den Eifelverein angemahnt (101). 1940 veröffentlichte Kaufmann eine Monographie „Der Grenzkreis Malmedy in den ersten fünf Jahrzehnten der preußischen Verwaltung.“ Auch hier gibt es interessante Kontinuitäten, 1961 folgte der Anschlussband „Der Kreis Malmedy. Geschichte eines Eifelkreises von 1885 bis 1920.“ Das Buch, in dem auch das Wirken des Eifelvereins ausführlich gewürdigt wurde, gab der Bonner Historiker Heinrich Neu (1906-1976) aus dem Nachlass heraus; Kaufmann war 1944 bei einem Bombenangriff auf Bonn ums Leben gekommen (102).
Auf der 50-Jahrfeier des Eifelvereins hielt Kaufmann 1938 in Trier eine martialische Abschiedsrede. Zu seinem Nachfolger als „Vereinsführer“ wurde der Schleidener Landrat Dr. Josef Schramm (1901-1991) gewählt, der ebenfalls eine programmatische Ansprache hielt. Danach habe der Eifelverein bereits 1933 erklärt, dass er „in den volks- und heimatkundlichen Richtlinien der nationalsozialistischen Bewegung freudig seine alten Ziele erkennt, für die er besonders in schwerster Nachkriegszeit gearbeitet und gekämpft hat.“ Schramms besonderer Gruß galt den „Landsleuten jenseits der Grenze“, die „treu zu ihrem Volkstum stehen.“ Bereits zuvor waren die Ortsgruppen aus Eupen und Malmedy, die „abgetrennten Brüder aus Neubelgien“, herzlich begrüßt worden. Der Verein wolle die „Heimat- und Volkskunde“ fördern und dabei die „deutschen Volksgruppen im benachbarten Auslande in ihrem ehrlichen Volkstumskampf“ unterstützen (103).
Den belgischen Behörden blieben diese Äußerungen nicht verborgen, zumal sie auch in der Mitgliederzeitschrift, ab 1933 „Die Eifel“, und im Eifelkalender publiziert wurden. Positiv wurde dies von den „Westforschern“ wahrgenommen: Bereits 1931 wies der langjährige Schriftleiter der Vierteljahrsblätter, Martin Herold, auf den Eifelkalender für 1932 hin: Das Eifelland werde in seiner vollen Breite von „Eupen, Büllingen, St. Vith bis … zum luxemburgischen Oesling“ abgedeckt (104). Das Amt Thedieck versorgte Interessenten in Eupen-Malmedy großzügig mit Literatur, so 1938 mit 20 Exemplaren von „Mein Kampf“ und 1936 mit 1.000 Eifelkalendern (105). Die belgischen Behörden beäugten die Vereinsaktivitäten deshalb kritisch, verboten den Staatsbeamten die Mitgliedschaft im Eifelverein und setzten auch Lieferanten für staatliche Einrichtungen unter Druck. Nach der Annexion begrüßte die Mitgliederzeitschrift die Deutschbelgier bei ihrer „Rückkehr in das Vaterland des Großdeutschen Reichs“ und ging damit weit über die Positionen hinaus, die der vorsichtige Zender und die zurückhaltende Militärverwaltung vertraten (106).
2.4 Assistent und Professor für Volkskunde in Bonn (1945-1993)
Ab dem 1.11.1949 war Zender wieder Assistent in Bonn. 1954 habilitierte er sich mit der bahnbrechenden Untersuchung „Räume und Schichten mittelalterlicher Heiligenverehrung in ihrer Bedeutung für die Volkskunde. Die Heiligen des mittleren Maaslandes und der Rheinlande in Kultgeschichte und Kultverbreitung“ (1959, 2. Auflage 1973) für das Fach „Deutsche Volkskunde“ (107). Wie seine Studien zur Sagenforschung und zur Sprachgeschichte waren auch seine Arbeiten zur Heiligenverehrung der fächerübergreifenden Kulturraumforschung und der kartographischen Methode verpflichtet, aber auch der katholischen und humanistischen Bildungstradition, die seine ganze Vita bestimmte.
Für die Probevorlesung schlug er drei Themen vor: „Die kulturelle Krise des Landvolks und die deutsche Volkskunde“ (angenommen), „Eigenart und Entwicklung des Brauchtums in den Rheinlanden“ sowie „Märchen, Sage und Schwank in ihren Beziehungen und in ihrer Abgrenzung gegeneinander.“ Für die Antrittsvorlesung lauteten die Themen: „Die Wandlung der sozialen Struktur heutiger Industrielandschaften in ihrer Auswirkung auf das volkskundliche Erscheinungsbild“, „Überschichtungen und Veränderungen volkskundlicher Erscheinungen in Grenzgebieten eines Kulturraumes“ (Thema in Anlehnung an das ursprüngliche Habilitationsvorhaben) und „Mundartliche Wortverbreitungskarten in ihrer Bedeutung für die Volkskunde.“
Das Thema der Habilitationsschrift, Heiligenverehrung, Wallfahrt und Volksfrömmigkeit im Rheinland und in der Eifel, zieht sich wie ein roter Faden durch Zenders gesamtes Werk. Genannt seien hier nur ein Aufsatz über „Schutzheilige der Haustiere“ (1935) und über die drei Matronen und ihre Nachfolgerinnen (1940) sowie größere Veröffentlichungen über die Heiligen Quirin von Neuss, Maximin von Trier und Severin von Köln (108). Letztere waren Beihefte zu Karten im „Geschichtlichen Atlas der Rheinlande“, die mustergültig die räumliche Ausstrahlung eines Trierer und eines Kölner Heiligenkultes analysierten (109). Kleinere Aufsätze widmete er den Heiligen Apollinaris, Cassius, Dionysius, Florentius, Hubertus, Karl dem Großen und Remigius (110).
Von 1954 bis 1958 war Zender als Privatdozent in Bonn tätig, habilitierte sich dann nach Köln um. Vermutlich wollte man den Eindruck einer Hausberufung vermeiden. In Köln hatte er bereits seit 1954 – die Personalakten geben hier unterschiedliche Daten an – einen unbesoldeten Lehrauftrag. 1960 wurde er als Nachfolger von Karl Meisen zum außerordentlichen, 1963 zum ordentlichen Professor an der Universität Bonn ernannt. 1964 wurde nach der Berufung von Rudolf Schützeichel (1927-2016) die Abteilung für Rheinische Sprachgeschichte mit dem Rheinischen Wörterbuch von der Abteilung für Rheinische Volkskunde getrennt. Bis zu seiner Emeritierung 1974 leitete Zender das volkskundliche Seminar und die Abteilung für rheinische Volkskunde am Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande. 1976 konnte er das 50-jährige Jubiläum seines ersten Besuchs in diesem Institut feiern, das nach seinem Heimatdorf zum zweiten Fixpunkt in seinem Leben geworden war.
Seit 1955 leitete Zender die neu gegründete Volkskundliche Arbeitsstelle des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) beim Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, zunächst hauptberuflich als Landesverwaltungsrat, seit 1960 dann in seiner Funktion als Lehrstuhlinhaber. Diese existiert noch heute als Fachabteilung des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte. Zenders Seminar und das renommierte Bonner Institut gibt es dagegen nicht mehr. Es bleibt zu hoffen, dass die Juniorprofessur für Kulturanthropologie und Volkskunde am Institut für Archäologie und Kulturanthropologie seine Arbeit fortsetzt.

Karl Leopold Kaufmann, Porträtfoto. (Eifelverein - Hauptgeschäftsstelle und Eifelbibliothek)
Zenders vielfältige Aufgaben und Projekte, aber auch seine Herkunft aus der Eifel, die keineswegs den Blick auf überregionale Zusammenhänge verstellte, prägten auch seine Lehrtätigkeit. Eine ganze Generation von Volkskundlern und Sprachwissenschaftlern saß vor seinem Katheder beziehungsweise begleitete ihn bei der Feldforschung und auf Exkursionen. Geblieben ist die Erinnerung an den „heiligen Zender“, den „fast allwissenden Zender“ (111).
Nachdem Zender bereits als Schüler Fragebögen für das Rheinische Wörterbuch ausgefüllt hatte, blieb er dem neunbändigen Werk auch während seiner weiteren Tätigkeit eng verbunden. Nach dem Tod des langjährigen Bearbeiters Heinrich Dittmaier (1907-1970), der von 1946 bis 1970 das Wörterbuch betreute, brachte Zender 1971 den letzten Band zum Abschluss (112). Bereits 1929 war Zender mit dem Aufbau der Landesstelle Rheinland des Atlas der deutschen Volkskunde betraut worden (113). Der Arbeit der Berliner Atlas-Zentralstelle stand er kritisch gegenüber. Zunächst einmal betonte er, dass es nicht die Aufgabe der Volkskunde sei, die Thesen der Sprachgeographie zu bestätigen (114). Weiter glaubte er, dass „historische Strömungsrichtungen“ nicht „volkstumsgeographisch“ durch Blut und Boden bedingt seien und auch nicht, dass sie in grauer germanischer Vorzeit entstanden sind, sondern ein Erbe des christlichen Mittelalters seien (115). 1954 erhielt Matthias Zender den Auftrag, die neue Folge des Volkskunde-Atlas herauszugeben. Dieses Werk brachte er 1984 mit 84 Kartenblättern, rund 2.000 Seiten Erläuterungen und drei Beiheften zum Abschluss. Auch hierbei spielten die kartographische Methode und der kulturräumliche Forschungsansatz eine wichtige Rolle. Weniger Erfolg hatte er mit einem größeren Projekt: Von dem Ethnologischen Atlas Europas erschien nur die erste Lieferung „Die Termine der Jahresfeuer in Europa.“
1971 verfasste Zender mit seinem Schüler, dem Münsteraner Volkskundler Günter Wiegelmann (1928-2008) und seinem Marburger Kollegen Gerhard Heilfurth (1909-2006) eine Einführung in die Volkskunde. Zender steuerte dazu ein großes Kapitel über „Glaube und Brauch. Fest und Spiel“ bei, in dem er sich unter anderem mit der Rolle unterschiedlicher Konfessionen beschäftigte, sowie eine Zusammenschau „Zeiträumliche Betrachtung. Ergebnisse der Kulturraumforschung“, in der er nachdrücklich die Berücksichtigung aktueller Entwicklungen anmahnte.
Eine weitere Gesamtschau veröffentlichte Zender in der Neubearbeitung der „Rheinischen Geschichte“, die in den 1970er Jahren in Angriff genommen wurde. Während die Teilbände über das Mittelalter und die Frühe Neuzeit ein Fragment blieben und sich zudem auf die politische und die Verfassungsgeschichte konzentrierten, steht der Band über „Wirtschaft und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert“ ganz in der Tradition einer interdisziplinären Landesgeschichte und greift zudem erfreulich weit in das 20. Jahrhundert hinüber (116). Neben Beiträgen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, zur Kirchen- und Schulgeschichte sowie zur Literatur- und Kunstgeschichte findet sich auch ein 108 Druckseiten umfassender Beitrag von Zender über „das Volksleben in den Rheinlanden seit 1815.“ Darin behandelt er die Geschichte der rheinischen Volkskunde sowie den „Wandel des Volkslebens“ von 1830 bis 1930. Er zeigt das Verschwinden, den Wandel und das Aufkommen neuer Bräuche auf und analysiert die kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ursachen. In einem weiteren Schritt werden ländliche und industrielle Gebiete charakterisiert, bevor er abschließend recht kurz die Entwicklung von 1930 bis 1970 in den Blick nimmt.
Zender starb 1993 im Alter von 86 Jahren und wurde neben seiner Frau auf dem Friedhof in Niederweis beigesetzt. Von den zahlreichen Ehrungen seien nur drei hervorgehoben: 1972 gaben seine Kollegin Edith Ennen und sein Schüler Günter Wiegelmann eine Festschrift zu seinem 65. Geburtstag heraus, die in zwei Bänden mit 1.262 Druckseiten 83 Beiträge vereinigt. Sie zeigt nicht nur die Bandbreite der Interessen des Jubilars, sondern auch das Ausmaß seines wissenschaftlichen Netzwerkes. Einen zentralen Schwerpunkt bildet die Kulturraumforschung, es folgt der nicht minder interessante Themenbereich Heiligenverehrung und religiöse Volkskunde, dann Volksglauben und Brauch, Alltag und Sachkultur, mündliche und literarische Volksüberlieferung sowie Sprach-, Landes- und Kirchengeschichte (117).

Matthias Zender auf Exkursion nach Echternach und Speicher, undatiert, Foto: Foto: Bärbel Kerkhoff-Hader.
Fünf Jahre später gaben Zenders Schüler Heinrich L. Cox und Günter Wiegelmann eine zweite Festschrift heraus. Sie versammelte anlässlich seines 70. Geburtstages 1977 unter dem Titel „Gestalt und Wandel“ auf 471 Druckseiten insgesamt 22 Aufsätze des Jubilars „zur rheinisch-westfälischen Volkskunde und Kulturraumforschung.“ Die drei Sektionen behandeln Themen der kulturräumlichen Differenzierung, Volksglauben und Volksbrauch sowie Volkserzählungen und Volkssprache (118). Schließlich sei noch das zum 80. Geburtstag Zenders von Josef Mangold zusammengestellte Schriftenverzeichnis erwähnt, das seine zahlreichen Bücher, Aufsätze und Lexikonartikel anführt (119).
Die gesammelten Aufsätze und die Publikationsliste sind heute außerordentlich wichtige Quellen, weil nicht nur das Bonner Institut mit seiner interdisziplinär ausgelegten kulturräumlichen Konzeption zu bestehen aufgehört hat, sondern auch die Volkskunde heute andere Schwerpunkte verfolgt. So ist der Bereich der religiösen Volkskunde und der Heiligenverehrung weitgehend in den Hintergrund getreten. Thema ist heute nicht mehr die alte, die untergegangene Eifel, sondern die moderne Eifel mit Neubaugebieten, Pendlerströmen und Halloween-Partys, zu denen inzwischen auch per Facebook eingeladen wird (120).
3. Die Sagen und Märchen der Eifel
Sammlungen von Sagen und Märchen gibt es seit dem 19. Jahrhundert in großer Zahl, erinnert sei nur an die Märchen der Gebrüder Grimm, Karl Joseph Simrocks Rheinsagen oder das Buch „Sitten und Bräuche, Lieder, Sprüchwörter und Räthsel des Eifeler Volkes ...“ des Gillenfelder Pfarrers Johann Hubert Schmitz (1807-1882) von 1856. Er hatte erkannt, dass diese „in Folge der veränderten Zeitverhältnisse mit jedem Tag mehr und mehr aus dem Gedächtnisse und Leben des Volks schwinden.“ Da die Bewohner der Eifel „wenig mit Fremden in Verkehr kamen“ sowie ein „einförmiges und von so manchen Mühen und Entbehrungen gedrücktes Leben“ führten, seien hier noch „Sitten und Bräuche aus vorchristlicher Zeit und von unsern noch heidnischen, altdeutschen Vorfahren“ überliefert. Anzuführen sind außerdem die beiden Sagensammlungen des Volksschullehrers Heinrich Hoffmann (1848-1917) aus Breitenbenden (heute Stadt Mechernich) über die Sagen des Rur- und des Indegebietes (1911, 1914). Als Vorbilder für Zenders Sammelwerk werden auch Nikolaus Gredts (1834-1909) „Sagenschatz des Luxemburger Landes“ (1883) und die „Sagen des Bergischen Landes“ von Otto Schell (1858-1931) aus dem Jahre 1897 genannt (121).

Hefte und Kalender mit der Urschrift der Sagen der Westeifel, 1929-1936. (Nachlass Matthias Zender)
Was Matthias Zender mit seinen, ansprechend mit Fotos der Eifel und einiger Erzähler ausgestatteten, „Volkssagen der Westeifel“ (372 S.) und seinen „Volksmärchen und Schwänke aus der Westeifel“ (171 S.) von 1935 vorgelegt hat, war dagegen eine umfassende und systematische Dokumentation des Gedächtnisses seiner Heimat, des mündlichen Erzählguts einer ganzen Region. Im Vorwort der „Volkssagen“ berichtet er, dass er in den Jahren 1929 bis 1934 und zum Teil auch schon von 1924 bis 1927 zahlreiche Reisen durch die Westeifel unternommen hatte. Dabei konnte er ein geschlossenes Gebiet erforschen: Die damaligen Kreise Bitburg und Prüm, den Norden des Kreises Trier sowie Teile der Kreise Daun und Wittlich, die deutschsprachigen Gebiete um Malmedy, St. Vith und Arlon sowie in Luxemburg. Es handelt sich um ein „Reliktgebiet“ im Sinne der Kulturraumforschung, das keine Städte besaß und „Jahrhunderte lang abseits des großen Kulturstromes“ lag, so dass sich hier „manche altertümliche Kulturerscheinung bis in unsere Tage“ erhalten hat.
Zu Fuß und mit dem Fahrrad zog Zender von Dorf zu Dorf und erkundigte sich zunächst beim Lehrer, dann in den Geschäften, Wirtschaften und Poststellen sowie bei älteren Bauern und Leuten, die vor der Tür saßen, nach Personen, die Geschichten erzählen konnten. 379 Erzähler machte er so ausfindig. Er fragte sie nach Geschichten aus alten Zeiten, die man sich an langen Winterabenden erzählte, und sprach sie dann gezielt auf Themen wie Hexen, Gespenster, Tempelherren, Raubritter, Schweden, alte Burgen, verfallene Klöster, ausgestorbene Dörfer, Glocken, Teufel, Zwerge, Heinzelmännchen, Werwölfe, Wilde Jagd, Hexen, Gespenster, Wiedergänger usw. an.

Hefte und Kalender mit der Urschrift der Sagen der Westeifel, 1929-1936. (Nachlass Matthias Zender)
Die Sagen zeichnete Zender in Gegenwart der Erzähler auf, wobei er Ausschmückungen vermied und Inkonsequenzen nicht bereinigte. Zender dokumentierte also die Sagen in ihrer ursprünglichen Kürze und ihrer spröden Form, ohne sie zu verschönern und auszuspinnen. Ein weiterer Vorzug seiner Arbeitsweise liegt in der Tatsache, dass er die Erzähler, ihr Erzählverhalten und die Erzählumstände und somit die ganzen Kontexte dokumentierte (122). Durch die Übertragung in die Schriftsprache ging zwar viel vom Charakter des Erzählens verloren, doch wurden viele Texte in der Mundart wiedergegeben. Erhalten sind in seinem Nachlass circa 100 Hefte und Kalender, von denen die Hälfte Mitschriften und die andere sorgfältig angefertigte Reinschriften enthält. Sorgfältig ist vermerkt, welche Hefte für die wesentlich erweiterte Neuauflage der Volkssagen von 1966 durchgesehen wurden. Tonfilm und Tonband standen ihm damals leider noch nicht zur Verfügung, allerdings experimentierte er mit Schallplatten (123).

Hefte und Kalender mit der Urschrift der Sagen der Westeifel, 1929-1936. (Nachlass Matthias Zender)
Zenders Buch war an ein breites Publikum adressiert, zunächst an die Wissenschaft, dann an die „Volksbildner“, die Lehrer, die es im heimatkundlichen Unterricht verwenden sollten, und schließlich sollte es ein „Volksbuch für breitere Kreise“ werden. „Für Leute allerdings, die beim Lesen dieses Buches über die ‚Rückständigkeit‘ der Westeifel staunen und über den ‚krassen Aberglauben‘ meiner Heimat lächeln, ist dieses Buch nicht geschrieben.“
Der zweite Band „Volksmärchen und Schwänke“ folgte noch im gleichen Jahr. Er enthält auf 171 Seiten 200 Geschichten aus einer Sammlung von 1.264 Texten sowie eine längere Einführung über „Erzählen und Erzähler in der Westeifel“. Es werde „in der Westeifel noch erzählt, wenn auch nicht mehr so oft und so viel wie früher.“ Erzählt werde in der Spinnstube, in der Werkstatt, in der Wirtschaft, bei der Kirmes, beim Verwandtenbesuch und in der Familie, wo man die Kinder ins Bett schickte, wenn die Gespenstergeschichten so richtig spannend wurden. Besonders freute man sich, wenn ein Handwerker oder Fuhrmann kam und neue „Steckelcher“ mitbrachte. Kritisch wird das Verhältnis von gedruckten Romanen und Erzählungen, von Kalendern und Zeitungen zum mündlichen Erzählgut hinterfragt. „Die Bauern halten meist heute ihre Tageszeitung, sie hören sonntags beim Wirt Radio.“ 4.000 Sagen und 1.264 Märchen habe er von 417 Erzählern gehört. Der Band endet mit einem Appell zur Erhaltung der Erzählkultur, die zu einer bodenverbundenen Bauernkultur gehöre. Schließlich ist noch auf einen dritten, mit 106 Seiten eher handlichen Band hinzuweisen: Er trägt den Titel „In Eifel und Ardennen“ und erschien 1936 in der Reihe „Deutsches Grenzvolk im Westen erzählt.“

Herr Theis aus Winterspelt. (Zender, Volkssagen, 1935)
Zenders Bücher erschienen in gediegener Ausstattung und mit einer Reihe von Schwarzweißtafeln. Diese zeigen die Charakterköpfe einiger Erzähler, aber auch Szenen aus dem Dorfleben. So zeigt das Bild mit der Unterschrift „Nober erzählt“ eine Gruppe von zehn Personen, die sich um einen Küchentisch versammeln und einem Mann zuhören, der wohl auf einem Wohnzimmerstuhl Platz genommen hat. (Nober war ein Arbeiter in Pütscheid bei Prüm). Die Männer tragen Hüte und Mützen, die Frauen stricken Strümpfe, zu essen oder zu trinken gibt es nichts. Das Bild „Johann Schwinnen, Wilsecker, singt ein Lied vor“, macht darauf aufmerksam, dass Zender auch Lieder aufzeichnete. An anderer Stelle erwähnt er, von dem in einem Dorf bei Kyllburg lebenden Erzähler habe er über 200 Geschichten und 70 Lieder erhalten (124). Am Bonner Institut gab es ein umfangreiches Volksliedarchiv, das 22.000 Lieder dokumentierte (125). Man sieht den schweigenden Sänger im Sonntagsstaat mit Krawatte und Uhrkette, gegenüber der junge Zender, als Student ebenfalls in Anzug und Krawatte, wie er sich fleißig Notizen macht. Ein weiteres Bild zeigt einen raumfüllend platzierten Erzähler, der dem jetzt kurzgeschorenen Zender eine Geschichte erzählt, die dieser an einem halbrunden Tisch mit zwei Blumentöpfen mitschreibt. Ein viertes Bild zeigt die 80-jährige Bäuerin Frau Schneider aus Büdesheim bei Prüm, den Prototypen einer uralten Großmutter, die zusammengekauert im Sessel sitzt und ihren angespannt lauschenden Enkeln Geschichten erzählt: „Aß et nou wuhr aß, ich kann et net son, se han awer su verzahlt.“

'Nober erzählt'. (Nachlass Mathias Zender)
Freilich muss man bei all diesen Abbildungen berücksichtigen, dass es sich um Inszenierungen, um gestellte Fotos handelte. Dies gilt auch für eine Reihe von Aufnahmen, die sich im Archiv des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn erhalten haben. Sie zeigen Matthias Zender mit einem Assistenten bei der Sammlung von Sagen und Märchen in der belgischen Provinz Luxemburg und im belgischen Thommen während der 1930er Jahre. Befremdlich ist allerdings, dass die Bauern hier während der Feldarbeit oder auf dem Weg zur Arbeit befragt werden; einer steht an einem Zaun, ein anderer trägt eine Sense (126).
Zenders Wunsch nach einer größeren Verbreitung seiner Sammlung erfüllte sich. Von den „Volksmärchen“ erschien 1984 eine neu bearbeitete Fassung. Von den „Volkssagen“ kam 1966 unter dem Titel „Sagen und Geschichten aus der Westeifel“ eine von 1.300 auf 1.885 Texte erweiterte Neuausgabe auf den Markt, die 1980 und 1986 nachgedruckt wurde. Gegenüber der Erstausgabe wurde die Bildausstattung verändert, die Erzähler traten in den Hintergrund, malerische Ansichten der romantischen Eifel hingegen in den Vordergrund. Das Vorwort enthält interessante Hinweise auf Veränderungen in den 30 Jahren, die seit der Erstauflage vergangen waren. Zender berichtet, dass er die Sammlung 1936 abbrechen musste und 1938 nicht mehr aufnehmen konnte. Der Bau des Westwalls und „ständige Einquartierungen mit ihren wildfremden Menschen“ hätten viel Unruhe in die Eifel gebracht.

'Johann Schwinnen, Wilsecker, singt ein Lied vor'. (Nachlass Mathias Zender)
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich die Situation dann vollständig verändert. Die meisten Erzähler waren inzwischen verstorben, große Teile des Erzählgutes seien verloren gegangen. In den 1950er und 60er Jahren veränderte sich die Eifel dann in ungeheurem Tempo. Nicht nur das Erzählgut und die Techniken des Erzählens verschwanden, sondern auch die vorindustrielle Lebens- und Arbeitswelt in den Dörfern, von denen sie berichten. Zenders Märchen und Sagen dokumentieren somit das kulturelle Gedächtnis einer Region, das sich so weder aus Verwaltungsakten noch aus Zeitungen rekonstruieren lässt. Es ist ebenso verschwunden wie die traditionelle Landwirtschaft und die pittoresken Dörfer der „alten Eifel.“
Zender wollte ein Buch für Lehrer, den Heimatkundeunterricht und für breite Kreise der Bevölkerung schreiben. Wie steht es mit der seinerzeit an erster Stelle genannten wissenschaftlichen Erschließung? Heute ist die Erzählforschung eine etablierte Fachdisziplin. So gibt es zum Beispiel eine „Kommission Erzählforschung“ innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, die regelmäßig Tagungen veranstaltet und Publikationen herausgibt (127). Zender selbst hat mit seiner Dissertation „Die Sage als Spiegelbild von Volksart und Volksleben im westlichen Grenzland“ eine wichtige Grundlage geschaffen. Er untersuchte exemplarisch die Sagen über Zwerge, Hunnen, Tempelherren, Burgen und Dörfer sowie Schatzsagen und fragte nach der Herkunft und Entwicklung, nach der „Biologie der Sage“ und nach dem Verhältnis von Erzählern und Hörern. Hinzu kommt eine Vielzahl von Aufsätzen des Autors. Bereits 1937 hatte er seine Forschungen in einem Aufsatz „Quellen und Träger der deutschen Volkserzählung“ einer breiteren Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht (128).
Neben anderen Publikationen ist vor allem auf seine 1973 erschienene Studie „Volkserzählungen als Quellen für Lebensverhältnisse vergangener Zeiten“ hinzuweisen (129). Hier erörtert er einleitend die Frage nach dem Quellenwert von Sagen für die Lokalgeschichte. Zahlreiche Sagen besitzen einen ausgeprägt antifeudalen Charakter, sie kritisierten das gottlose und frevelhafte Leben der Raubritter und Mönche, die alle ihre gerechte Strafe erhielten. Dagegen schildern viele Erzählungen die Napoleonische Zeit recht positiv. Zender kann die Entstehung dieses Erzählguts in die 1830er bis 60er Jahre datieren. Germanisch oder mittelalterlich sind sie also nicht, auch wenn manche der Geschichten sich schon um 1220 bei Caesarius von Heisterbach und andere in den Schwankerzählungen der Reformationszeit nachweisen lassen (130). In jedem Fall erlebte man geistliche und weltliche Grundherrschaft im 18. Jahrhundert kaum noch durch Mönche und Ritter, sondern durch eine wohlorganisierte Verwaltung. Welche Rolle hier persönliches Erleben, literarische Vorbilder und die aufgeklärte Absolutismuskritik im Einzelnen gespielt haben, wäre noch genauer zu untersuchen. Es ist jedenfalls erstaunlich, dass unter der vielfach kritisierten preußischen Herrschaft die Zeit des Alten Reichs so negativ und die mit hohen Steuern und vielen Kriegszügen verbundene französische Zeit so positiv gesehen wurde, obwohl viele Bewohner der Westeifel 1798 im „Klöppelkrieg“ gegen die französische Herrschaft aufbegehrten.
In einem zweiten Teil wertet Zender seine Erzählungen als historische Quelle für verschiedene Bereiche der Volkskultur aus, zum Beispiel für die Kleidung und die Wohnungen der Bauern, die in Kyllburg mit Kittel und Zylinder in die Kirche gingen. Umfassend wird das Thema der Nachtarbeit thematisiert: Nachts brachte man die Pferde auf die Weide, bewässerte Gärten, drosch Getreide, buk Brot, machte Wurst und stahl Holz aus den Wäldern. Weiter untersucht Zender das Sammeln, Mähen und Dreschen, das vielfältige Handwerk auf den Dörfern, die Nachtwächter, Fuhrleute und Müller sowie die Hausierer, Bettler und Musikanten, die man Bayern nannte, da sie aus der bayerischen Pfalz stammten. Aus dem armen Musikantenland im Kreis Kusel kamen Zirkus-, Schiffs- und Kurkapellen, die die ganze Welt bereisten. Einige verschlug es sogar in die noch ärmere Eifel. Weiter lenkt Zender das Interesse auf die gut dokumentierten Erzfahrer, Köhler, Gerber und Fuhrleute. Untersucht wird auch das Leben in der Familie sowie das Verhältnis von Herren, Knechten und Mägden.

'Frau Schneider aus Büdesheim'. (Zender, Volkssagen, 1935)
3.1 Zum wissenschaftsgeschichtlichen Kontext der Sagensammlung: Was das Vorwort der „Volkssagen“ berichtet
Die „Volkssagen“ und die „Volksmärchen“ waren die ersten beiden Bände einer neu gegründeten Reihe „Deutsches Volkstum am Rhein“, die auch nach dem Krieg noch fortgesetzt wurde. Von besonderem Interesse sind dabei die Danksagungen der „Volkssagen“ von 1935, die sich als weitere wichtige Quelle zur Entstehungsgeschichte des Werkes erweisen. Zunächst nennt Zender seinen Mentor, den Sprachwissenschaftler und Volkskundler Josef Müller, dem das Buch auch gewidmet ist, dann den Sprachwissenschaftler und Mundartforscher Adolf Bach, und schließlich den Landeshistoriker Franz Steinbach, den langjährigen Direktor des Bonner Instituts.
Bach und Müller waren auch die Herausgeber der neu begründeten Reihe „Deutsches Volkstum am Rhein.“ Steinbach und vor allem Bach standen der NSDAP nahe. Eine neue, populär angelegte Reihe musste 1935 dem neuen Zeitgeist entsprechen, und nur so sind Zenders Schlusssätze seiner Einleitung zu verstehen: „Ich wollte durch diese Sammlung zeigen, welche Kräfte die Bauernkultur meiner Heimat bestimmt haben, wie sehr das Bauerntum der Westeifel heute noch in seine alte, gesunde Kultur eingebettet ist, wie wenig es bisher vom Stadtgeist erfasst worden ist. Beim Aufbau einer neuen Bauernkultur wird Bauerntum dieser Art wichtigste Dienste leisten.“ Weiterhin stattete Zender seinen Dank dem Vorsitzenden des Eifelvereins, Karl Leopold Kaufmann, ab. Der Eifelverein, der sich seit seiner Gründung 1888 auch die wissenschaftliche Erforschung der Eifel auf seine Fahnen geschrieben hatte, gab 1913 zu seinem 25-jährigen Jubiläum eine fundierte Eifelfestschrift heraus. 1921 eröffnete der Eifelverein auf der Genovevaburg in Mayen die Eifelbibliothek, die das komplette Schrifttum zur Geschichte, Landeskunde und Literatur der Region sammeln sollte, und 1925 rief der Verein mit dem Eifelkalender ein eigenes Jahrbuch ins Leben, das seit 90 Jahren eine Stütze des wissenschaftlichen und literarischen Lebens in der Eifel darstellt (131).
In den 1930er Jahren gab es eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen dem Eifelverein und dem Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande. Im Eifelvereinsblatt gab es bereits in den 1920er Jahren eine eigene Rubrik „Geschichtliche Mitteilungen vom Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande in Bonn“, die zum Beispiel 1929 neun kleine Beiträge enthielt, deren Spannweite von den Kreuzzügen bis zur Auswanderung reichte. Das Eifelvereinsblatt hatte 1929 eine Auflage von 16.500 Exemplaren. Auf diese Beiträge war auch das Institut stolz, in seinem Jahresbericht 1933/1934 schrieb Steinbach: „Durch regelmässige Mitarbeit beim Eifelvereinsblatt … wurde für die Verbreitung orts- und landesgeschichtlich wichtiger Forschungsergebnisse Sorge getragen und die Bestrebungen des Instituts in der breiteren Oeffentlichkeit bekannt gemacht.“ (132)
Eine ganze Reihe von Briefen zwischen Steinbach, Kaufmann und dem Schriftleiter Dr. Viktor Baur (1898-1967) belegen, wie Manuskripte für „Die Eifel“ akquiriert, begutachtet und redigiert wurden; die Autorenhonorare teilten sich die beiden Vereine. So erhielt 1935 Zender für seinen Aufsatz über die Briefe aus der Napoleonischen Zeit ein Honorar von 10 RM (133).
Karl Leopold Kaufmann war darüber hinaus ein überaus produktiver Autor. Das Eifelvereinsblatt verzeichnet fast 200 Beiträge aus seiner Feder, darunter zunächst viele Versammlungsberichte, dann zunehmend landesgeschichtliche Beiträge. Nachdem der Eifelverein 1926 mit dem Eifelkalender ein eigenes Jahrbuch begründete, steuerte Kaufmann insgesamt 25 Beiträge insbesondere zur Geschichte des 19. Jahrhunderts bei. Wir finden ihn nicht nur seit 1926 als Besucher von Tagungen des Bonner Instituts (134), sondern auch als Autor der Rheinischen Vierteljahrsblätter: 1932 veröffentlichte er einen Aufsatz über den aus Bitburg stammenden Burschenschaftler, Revolutionär und Teilnehmer am Hambacher Fest, Augustin Messerich (1806-1876), 1935 über den Kölner Revolutionär und Teilnehmer an der Nationalversammlung 1848, Franz Raveaux, und 1936 über „Die Eifel und ihre Bewohner im Urteil des kurtrierischen Leibarztes Salentin Cohausen.“
Auch als Buchautor trat Kaufmann hervor, neben den bereits genannten Büchern über Eupen-Malmedy gab er 1932 und 1936 die 28. und 29. Auflage des Eifelführers heraus, den 1888 sein Vorgänger Adolf Dronke begründet hatte und dessen Umfang seither von 192 auf 336 Druckseiten angewachsen war. 1926 veröffentlichte Kaufmann ein Buch „Aus Geschichte und Kultur der Eifel.“ Franz Steinbach lobte das Werk in einer Rezension als gelungene Zusammenschau, deutet aber auch leise Kritik an, dass ein recht bedeutender Teil des Büchleins den Verbesserungen gewidmet ist, „die in preußischer Zeit zum Teil durch staatliche Fürsorge, zum Teil durch die persönliche Initiative vieler Eifeler Heimatfreunde erreicht worden sind.“ (135) 1932 erschien eine erheblich vermehrte dritte Auflage, die Martin Herold sehr positiv rezensierte und als „Perle der Eifelforschung“ lobte (136).
Kaufmanns wissenschaftliche Leistung wurde am 24.12.1933 mit der Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät, der Universität Bonn ausgezeichnet. Der von einem namentlich nicht genannten Autor (Viktor Baur?) verfasste Bericht in der „Eifel“ bezeichnet dies als eine „Ehrung des Eifelvereins.“ Aus der Urkunde wird zitiert, Kaufmann habe „fast 30 Jahre lang als Führer [!] des Eifelvereins für Heimat und Volk sich die größten Verdienste“ erworben. Weiter werden die engen Beziehungen zwischen dem Eifelverein und der Bonner Universität hervorgehoben, die zum Beispiel in dem „großen Eifelwerk“ von 1913 ihren Niederschlag gefunden hätten (137).
Steinbach war bereits 1933 in den Hauptvorstand des Eifelvereins gewählt worden und gehörte wahrscheinlich auch dem 1954 konstituierten wissenschaftlichen Ausschuss an (138). 1938 hielt Steinbach auf der 50-Jahrfeier des Eifelvereins in Trier den Festvortrag über das Thema: „Die deutsche Leistung der Eifel“. Nach dem „Wimpeleinmarsch von 107 Ortsgruppen unter Führung von Fahnen der Partei und der SA“ referierte er, die Eifel sei schon immer ein wehrhaftes „Bollwerk des Deutschtums gegen die Gefahr aus dem Westen“ gewesen, habe Großes bei der Niederringung des Separatismus geleistet, und ihr „gesundes Blut“ nach Siebenbürgen, ins Banat und nach Bosnien, vor allem aber nach Amerika geschickt; „überschüssige Volkskraft“ sei außerdem an die großen Städte abgegeben worden (139). Noch 1957 referierte Steinbach auf der Hauptversammlung in Köln über die Frage, „wie die Eifel zum Grenzland wurde.“ (140)
Auch wissenschaftsorganisatorisch spielten Kaufmann und der Eifelverein in den 1930er Jahren eine wichtige Rolle: Als die Provinzialregierung 1930 eine Kommission zur Herausgabe eines Volkskundeatlasses bildete, wies Steinbach darauf hin, dass „Geheimrat Kaufmann sehr verschnupft sei“, dass man ihn übersehen hatte (141). 1933 nahm Kaufmann an einer Mitarbeiterbesprechung zu einem Projekt zur „Erforschung der rheinischen Auswanderungsgeschichte“ teil, bei der die „Mittlerstellung“ des Bonner Instituts „zwischen der allgemeinen Wissenschaft und dem Lokalforscher“ betont wurde (142). 1934 war Kaufmann stellvertretender Vorsitzender des Vereins für geschichtliche Landeskunde und organisierte in dieser Funktion die „Lehrgänge“ des Instituts, so im April 1934 in Bonn über „Saarfragen“ und im Juli 1934 die „Tagung“ in Saarburg. Auf der Veranstaltung äußerten Teilnehmer den dringenden Wunsch, so Steinbach am 13.5.1935 an Apffelstaedt, die nächste Tagung im Juli 1935 in Merzig mit einer „Fahrt durch das befreite Saarland“ zu verbinden. Im Juni 1937 organisierte Kaufmann Lehrgang und Tagung in Bonn zu Themen der Grenzlandforschung, wobei die „Grenzlandvolkskunde“ breiten Raum einnahm: Neben Matthias Zender referierte Wilhelm Bodens (1910-2005), der im gleichen Jahr (1937) über Sagen am Niederrhein promovierte, über „Volkserzähler am Niederrhein und im westdeutschen Grenzland (mit Vorführung von Schallplatten).“ (143) Anschließend stand auf dem Programm: „Vorführung einzelner Schallplatten aus dem ‚Lautdenkmal reichsdeutscher Mundarten zur Zeit Adolf Hitlers.‘“ Weiter wurde eine Exkursion als „Kraftwagenfahrt durch das Drachenfelser Ländchen“ angeboten.
1938 fragte Steinbach bei Apffelstaedt an, ob dieser beziehungsweise Landesverwaltungsrat Dr. Hans Kornfeld oder, wie bisher, Kaufmann, die nächste Tagung leiten solle. 1939 bat Steinbach Apffelstaedt, den abwesenden Kaufmann zu vertreten. Dadurch konnte dieser am 13.5.1939 einen Vortrag von Matthias Zender über „Das Deutschtumsgebiet um Arel in der belgischen Provinz Luxemburg“, hören, dessen gleichnamiges Projekt er zwei Monate zuvor torpediert hatte (144).
3.2 Die Förderung von Zenders Forschungen durch den Eifelverein
Eine weitere wichtige Quelle zur Geschichte von Zenders Sammlungen sind zwei Artikel im Eifelvereinsblatt von 1930 (145). Hier findet sich ein „Aufruf zur Mitarbeit an einer Sagensammlung der Eifel.“ Er verweist einleitend auf die gedruckten Sammlungen von Rektor Michael Zender (gestorben 1932) für die Eifel (146) und die Bücher der Herren Gredt und Schell für Luxemburg beziehungsweise das Bergische Land. Dann wird mitgeteilt, der Eifelverein, das Bonner Institut für geschichtliche Landeskunde und das Rheinische Wörterbuch hätten beschlossen, eine Sammlung aller Sagen der Eifel anzulegen, und zwar sowohl der gedruckten als auch der „heute noch im Volksmund“ lebenden. Ihr „Beauftragter stud. Matth. Zender“ habe bereits 1.800 Geschichten im Bitburger Land gesammelt, das durch seine günstige Verkehrslage stark unter städtischem Einfluss stehe. In den „abgeschlossenen Gebieten der Hocheifel“ sei noch weitaus mehr zu erwarten. Bisher sei Zender von einigen Lehrern und „Heimatfreunden“ unterstützt worden. Jetzt werden alle Mitglieder des Eifelvereins angesprochen: Man bittet um Nachrichten über Sagensammlungen, die noch ungedruckt sind, um Hinweise auf Veröffentlichungen in Zeitungen und um die Namen potentieller Geschichtenerzähler, die Zender dann persönlich aufsuchen wollte. Für die Mitteilung von Sagen (wenn möglich in Mundart) werden konkrete Vorgaben gemacht, sie sollten an das Bonner Institut in der Poppelsdorfer Allee eingesandt werden.
Der Artikel macht zwei Tatsachen deutlich: Zenders Sagensammlung war nicht nur ein privates Dissertationsvorhaben, sondern ein offizielles Forschungsprojekt des Bonner Instituts in Kooperation mit dem Rheinischen Wörterbuch und dem Eifelverein. Deshalb wurde er zeitgleich auch in den Mitteilungen des Instituts veröffentlicht (147). Mit dem Eifelvereinsblatt erreichte man ein interessiertes und sicherlich auch hilfsbereites Publikum in nahezu jedem Eifeldorf. Das Bild des Doktoranden, der zu Fuß und mit dem Fahrrad durch die Dörfer reist und sich von Haus zu Haus nach Erzählern durchfragt, muss also etwas relativiert werden. Zudem macht der Aufruf deutlich, dass auch niedergeschriebene und gedruckte Sagen gesammelt wurden und keineswegs nur mündlich tradierte (148).

Teildruck der Dissertationsschrift.
Einige Seiten weiter findet man einen Artikel von cand. phil. Math. Zender „Zur Sagenforschung der Eifel“, in dem er kurz und bündig einen Überblick zu den verschiedenen Sagentypen gibt, von den Schwänken über die historischen Sagen bis hin zu den Toten-, Hexen-, und Werwolfgeschichten. Auch die Bedeutung der Sagenforschung für Landesgeschichte und Volkskunde wird hervorgehoben.
Als 1935 die „Volkssagen“ auf den Markt kamen, veröffentlichte der Gutsbesitzer und Dichter Max von Mallinckrodt (1873-1944) eine begeisterte Besprechung in der Mitgliederzeitschrift (149). Er feierte Zenders Werk als „Schatz echtesten Eifeler Sagengutes“. Durch die korrekte wissenschaftliche Dokumentation und den Verzicht auf Zusätze und Ausschmückungen sei „die schlichte Schönheit des echt Volkhaften“ erhalten geblieben.
3.3 Zenders Veröffentlichungen in den Periodika des Eifelvereins
Zender hat vor allem in den 1930er Jahren eine ganze Reihe von Aufsätzen im Eifelvereinsblatt und im Eifelkalender publiziert: Bereits 1931 veröffentlichte er hier sein Erstlingswerk über die „Bräuche am Johannestage in der Westeifel“ (150) und 1933 einen Artikel über die Behandlung von Zahnschmerzen in der Volksmedizin: Wenn Branntwein, Kümmelöl und ein Pflaster mit Pfeffer und Salz nichts nutzen, legte man heiße Kartoffeln oder Kleie auf beziehungsweise rieb die Wange mit Petroleum oder Schmierseife ein. Man konnte auch „homnepatisch Trepfen“ verwenden, ein Vaterunser sprechen, den Schmerz ignorieren oder ihn seinem ärgsten Feind an den Hals wünschen. Wenn auch ein dickes Tuch um die geschwollene Backe nicht half, konnte man immer noch zum Zahnarzt gehen „und sich den Quälgeist ausreißen … lassen.“ (151)

'Bauer D. aus Oviat bei Malmedy'. (Zender, Quellen und Träger, 1937)
1935 veröffentlichte Zender Soldatenbriefe aus der napoleonischen Zeit (152), 1936 über Eifelhasen und über die Sagenerzähler der Westeifel (153). 1937 schrieb er einen Artikel über den Alten Fritz in den Schwänken der Eifel, womit allerdings nicht der Preußenkönig, sondern der legendäre Barbarossa gemeint war (154), und 1941 über die Zwergsagen. Hier gelang ihm der Nachweis, dass diese Sagen genau in den Gegenden verbreitet waren, in denen sich römische Siedlungsreste befinden. Hierzu gehörten auch die Fußbodenheizungen (Hypocausten), deren Funktion man sich nicht erklären konnte und die man als Wohnungen der Wichtelmänner deutete (155).
Als Forum für seine Publikationen benutzte Zender auch die Rheinische Heimatpflege, das Organ des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz. Die 1906 gegründete Organisation arbeitete von den 1930ern bis in die 1980er Jahre eng mit dem Eifelverein zusammen, die Vorsitzenden Josef Schramm und Konrad Schubach (1914-2006) setzten sich gemeinsam mit dem RVDL-Geschäftsführer Dr. Josef Ruland (gestorben 2000) für die Denkmalpflege im ländlichen Raum ein, für die Erhaltung der historischen Ortskerne und wertvoller Bausubstanz, die durch die fortschreitende Modernisierung zunehmend gefährdet war, aber auch für den Natur- und Landschaftsschutz (156). 1938 war der Verein ebenfalls gleichgeschaltet, als Herausgeber der Zeitschrift firmierte der Landeshauptmann der Rheinprovinz (157). Zenders Aufsatz „Bäuerliches Erzählgut“ lobt den Bauern als „Träger der Glaubens- und Vorstellungswelt unserer Ahnen in germanischer Zeit.“ Verschiedene Sagenthemen werden vorgestellt, Karten der Zwergen- und Schildasagen erläutert und mehrere Charakterköpfe von Erzählern abgebildet.

'Bauer P. aus Thommen b. St. Vith, ein rheinicher Volkserzähler'. (Zender, Erzählgut 1938)
3.4 Zenders Entgleisungen: 1932-1934, 1954-1956
In den 1950er bis 1980er Jahren finden sich weitere Artikel von Zender in den Periodika des Eifelvereins, die sich mit dem Brauchtum und den Mundarten, vor allem aber mit den rapiden Veränderungen der Eifel und ihrer Dörfer in der Nachkriegszeit befassen. 1956 veröffentlichte er einen Beitrag über „das Brauchtum der Eifel in unserer Zeit“. Er unterschied dabei die Westeifel als „Hort altertümlicher Formen“ von der Vorder- beziehungsweise Hocheifel, die durch bessere Verkehrsanbindung und die Nähe zu städtischen Zentren eine ganz andere kulturelle Prägung aufweise. Weiter analysierte Zender die Veränderungen seit den 1930er Jahren, nicht nur durch den Krieg, sondern auch durch die „Rationalisierung und Technisierung der Landwirtschaft.“ Die traditionellen Arbeitsgemeinschaften der Familien hätten sich weitgehend aufgelöst. An die Stelle der Dorfgemeinschaften seien die Vereine als Träger des Brauchtums getreten. Abschließend formulierte Zender neue Aufgaben der Brauchtumspflege in einer sich schnell wandelnden Zeit. Er betonte dabei die Bedeutung der Bewahrung der Überlieferung, die „zur Bindung an Gemeinschaften und Vergangenheit“ führt und einen „Traditionsverlust“ verhindert.“ (158)
3.5 Zenders Antrittsvorlesung über die kulturelle Krise des Landvolks 1954
Zenders Beitrag von 1956 geht im Kern auf seine Bonner Antrittsvorlesung über das Thema „Die kulturelle Krise des Landvolkes und die deutsche Volkskunde“ im Jahre 1954 zurück, die 1955 in den Vierteljahrsblättern veröffentlicht wurde (159). Zunächst unterstrich er die Bedeutung dieses Themas für die aktuelle volkskundliche Forschung. Er erwies seinem Lehrer Adolf Bach eine Referenz und kritisierte Hans Naumann, dessen Theorie vom gesunkenen Kulturgut in manchem zu mechanisch sei und das Volk viel zu passiv einschätze. Die Entwicklung der Städte habe gewaltig an Dynamik gewonnen. Auf dem Lande gebe es seit dem 18. Jahrhundert ebenfalls Veränderungen, die er mit den Schlagworten Mechanisierung (Schlepper, Mähdrescher), Kunstdünger, Pflanzenschutzmittel, aber auch wirtschaftlichem Denken (Rentabilität, Kalkulieren) charakterisiert. Bis etwa 1880 sei es Brauch gewesen, nach der Feldarbeit gemeinsam und Volkslieder singend nach Hause zu gehen, jetzt würden die Arbeiter zu verschiedenen Zeiten die Felder verlassen und nicht mehr singen. Das Landvolk lebe heute in einer „Zwischenwelt“ zwischen Stadt und Land, zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen Vergangenheit und Zukunft, was zur Orientierungslosigkeit führe. „Niemand, der in auf dem Lande groß geworden ist, findet in der Stadt seine geistige Heimat. Die Stadt bleibt ihm fremd, und er im Grund dort heimatlos.“ Der genannte Strukturwandel sei nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein „kulturelles und geistiges Problem.“ Volkstumsforscher und Heimatpfleger bemühen sich um die Erforschung und den Erhalt des Brauchtums, wobei Zender eine strenge Trennung zwischen beiden Bereichen fordert. Dann kommt er zu dem Ergebnis: „Es ist unsere Pflicht, die Probleme zu sehen, wie sie sind. Nach dem Niederbruch einer Jahrtausende alten Kultur in unseren Jahrzehnten muß in manchem eine neue Grundlage und ein neues Landvolk entstehen.“
3.6 Die Erstfassung über die Wandlungen im Bauerntum der Westeifel von 1934
Um diese beiden Aufsätze von 1955 und 1956, die wissenschaftliche lange und die populäre kurze Fassung, richtig einordnen zu können, muss man auf eine ältere Fassung dieses Textes zurückgreifen. 1932 hatte der damals 25-jährige Zender vor dem Verein ehemaliger Landwirtschaftsschüler in Bitburg einen Vortrag gehalten, der Anfang 1934 unter dem Titel „Wandlungen im Bauerntum der Westeifel“ in den Rheinischen Vierteljahrsblättern erschien (160). Versuche, die wirtschaftliche Notsituation des Bauernstandes zu verbessern, begann er, seien gescheitert, weil sie deren Wurzel nicht bekämpft hätten. Ursache sei die „einseitige und schematische Übertragung kapitalistischer und liberaler Methoden aufs Land.“ Dies habe nur geschehen können, weil sich „die Bauernkultur, die Geisteshaltung des Bauern geändert hatte.“ Danach analysiert Zender die Situation in seiner Heimatregion und kommt zu dem Ergebnis: „Aber im Kern ist das Westeifeler Bauerntum noch gesund.“ Dann geht er auf die „alte Bauernkultur vor diesem Umsturz“ ein, „die erd- und volksgebunden war.“ Er stellt die eigenwillige „prälogische“ Denkweise der Bauern heraus, betont die feste Ordnung, die Hilfsbereitschaft der Nachbarn und der Dorfgemeinschaft, die Rolle der Verwandtschaft, das Standesgefühl und die Zusammengehörigkeit, die „Schollenverbundenheit“ und die konservative Geisteshaltung. „Aus dieser starken Religiosität und den Bindungen an die Gemeinschaft entspringen auch die hohen sittlichen Werte, die im Bauerntum enthalten sind.“ Uneheliche Geburten gälten als Schande, betroffene Personen seien im vorigen Jahrhundert nach Amerika ausgewandert (161). Die Zahl der ehelich geborenen Kinder sei dagegen hoch, ein Geburtenrückgang kaum zu erkennen.
Diese intakte bäuerliche Kultur wurde seit dem 19. Jahrhundert durch die Stadtkultur mit ihrem „übermächtigen Einfluss“ zunehmend „gestört.“ Die Aufklärung habe den „Individualismus und Liberalismus“ gefördert, die auf das Land übergegriffen hätten und dort „verderblich wirken mußten.“ Neid und Großmannssucht ruinierten die bäuerliche „Geisteshaltung.“ Der Arbeiter brachte aus den Industriegebieten in Luxemburg, an Ruhr und Saar „Ideen, moralische Anschauungen“ mit, die „zur Vergiftung seiner Heimat“ beitrugen. Ähnlich die Mädchen aus reicheren Familien, die in einem Pensionat erzogen wurden, oder solche aus weniger bemittelten Kreisen, die als Dienstmädchen in der Stadt arbeiteten. Zunächst widerstand die Dorfgemeinschaft den neuen Sitten, doch dann wollten immer mehr Bauern „Warenhausmöbel“ statt solche vom Schreiner. Um 1850 habe noch jedermann an Hexen, an die Macht der Geistlichen und an den Teufel geglaubt.
Jetzt referiert Zender ausführlich über seine Forschungen. Dann geht er über zu den Wandlungen des Brauchtums, zum Schwinden der gemeinschaftlichen Unternehmungen. Durch die Einführung der Mähmaschinen sei das Singen von Volksliedern auf dem gemeinsamen Heimweg entfallen. Auch die Rolle von „Kirche, Schule und Obrigkeit“ in diesem Prozess wird analysiert. „Noch fast nicht aufgegeben hat meine Heimat … die ethisch, moralisch und sozial wertvollen Anschauungen und Auffassungen, die etwa ihren Ausdruck in der Religion, im Familienleben und im Wirtschaftsleben finden.“ In anderen Gegenden, im Norden der Eifel und im Kreis Malmedy, sei das anders. Da tragen nur noch die alten Frauen die Tracht, die jungen städtische Mode und schneiden ihre Haare kurz (Bubikopf!). „Die Frau will nicht mehr auf dem Felde arbeiten. Hauseinrichtungen sind zum großen Teil städtisch.“ Häuser werden nach Stadtbauweise aus Kunststeinen hergestellt. Dann zieht Zender ein Fazit: „Im Großen gesehen aber ist der Einbruch der Stadtkultur aufs Land von Verderben gewesen.“ Am Ende des 19. Jahrhunderts verließen die Eifler, vom „Materialismus“ bestimmt, ihre Heimat, zumal Industriearbeit als „leichter“ gegolten habe. Die Amerikaauswanderung sei eine weitere „Psychose“ gewesen.
Dann kommt Zender zur Gegenwart: Inzwischen sei der „Wert des Bauernstandes für die Volksgemeinschaft“ erkannt worden. Er sei wichtig für „eine eigene Ernährung“, die nur durch einen „mittelbäuerischen Berufstand“ gewährleistet werden könne. „Großkapitalistische“ Organisationsformen wie die Kollektive in Russland und die Rittergüter hätten sich nicht bewährt, aber mittelbäuerliche Betriebe, wie sie jetzt durch das Erbhofgesetz geschützt werden. Weiter sei ein gesundes Bauerntum „auf bevölkerungspolitischem Gebiet“ von Bedeutung. Die Stadt lebe vom Land, dieses führe ihr „auch bessere, gesündere und kräftigere Menschen zu, es leistet Blutauffrischung. Diese Leute bringen vom Lande gesündere Sitten, ethnisch wertvolle Anschauungen mit.“ Weiter ruhen „im Bauerntum … kulturbildende und vor allem kulturerhaltende Kräfte.“
„Erst die bäuerliche Wirtschaftspolitik des Dritten Reiches ergreift in wirtschaftlicher Hinsicht Maßnahmen, die auf die bäuerliche Kultur Rücksicht nehmen. Vom Dritten Reich wird auch mit Recht ein Neuaufbau der deutschen Bauernkultur versucht. In der Richtung, die deutsche Bauernkultur weiterzubilden, scheinen mir die Bestrebungen des neuen Staates zu liegen. Man will das bäuerliche Brauchtum da, wo es noch blüht, erhalten, aber da, wo kein Brauchtum mehr besteht, will man neues bilden wie etwa die Maifeier, Sommersonnwende oder das Erntefest.“
Das „Dritte Reich“ wird also die geistige und wirtschaftliche Krise des Bauerntums beenden. Es wird eine „neue Bauernkultur“ entstehen, die in einem „gesunden Verhältnis“ zur Stadtkultur steht. In der katholischen Kirche werden die Wallfahrten wieder aufgenommen und auch in der evangelischen Kirche wird das Brauchtum belebt, wie der Schmuck der Altäre mit Blumen belegt. „Aus Heimatliebe und Schollengebundenheit“ entwickelt sich das Nationalgefühl des Bauern, „im Rahmen einer großen deutschen nationalen Bewegung wird der … das Bewusstsein der Einheit des deutschen Volkes gut bewahren können.“ Er soll ruhig Kulturformen, Kunstdünger und Maschinen aus der Stadt beziehen, aber mit einem neuen „Selbst- und Sendungsbewußtsein.“ Hierzu trage der Zusammenschluss zum Reichsnährstand vieles bei. „Der nationalsozialistische Staat wird in Zukunft den besonderen wirtschaftlichen Verhältnissen des Bauern Rechnung tragen.“ Dies bedarf jedoch großer Investitionen in die schulische Bildung sowie in die Schaffung von Genossenschaften. So wird es „im neuen Deutschland wiederum zu einer wahren Bauernkultur kommen.“ Zender endet: „Dann wird der Bauer auch in Zukunft bleiben, was er bisher war, der Rückhalt deutscher Volkskultur, die Kraftquelle unseres Volkes.“
Der Aufsatz „Wandlungen im Bauerntum der Westeifel“ von 1934 ist die politischste aller Veröffentlichungen Zenders, sieht man von einigen Bemerkungen in der Einleitung seiner Dissertation ab, die dem Umstand, dass das Bonner Institut eine neue, ansprechend gestaltete, populäre Schriftenreihe auf den Markt bringen wollte, geschuldet sein mag. Doch ansonsten war Zender in der Zwischenzeit auf Distanz gegangen: In keiner seiner Veröffentlichungen, auch nicht zu dem durchaus politischen Thema der sprachlichen Situation in Arlon oder in der propagandistisch angelegten Reihe der „Kriegsvorträge“, findet sich auch nur ein Satz, den man als Versuch einer Anbiederung an die Machthaber des „Dritten Reichs“ deuten kann. Auch sein Gesuch um eine finanzielle Förderung seiner Habilitation enthält keinen solchen Hinweis, obwohl es sich ebenfalls um ein hochpolitisches Thema handelte. Freilich war Zender formal seit 1933 Mitglied im NS-Lehrerbund, 1937 der NSDAP und 1940 im NSD-Dozentenbund.
„Wandlungen im Bauerntum der Westeifel“ ist jedoch nicht nur der politischste, sondern auch der am schlechtesten recherchierte Aufsatz, den Zender jemals veröffentlicht hat. Der Aufsatz lässt zwei inhaltliche und zeitliche Schichten erkennen: Zunächst handelt es sich um einen populärwissenschaftlichen Vortrag, der im Januar 1932 vor einem landwirtschaftlichen Verein gehalten wurde. Damals war Zender noch Mitglied des Zentrums und empfand, wie ein Schreiben von Edith Ennen überliefert, Sympathien für den Reichskanzler Heinrich Brüning (1885-1985, Reichskanzler30.5.1930-30.5.1932) (162). 1933 wurde der Vortrag dann überarbeitet und erschien 1934 im Januar- und Aprilheft der damals noch jungen Rheinischen Vierteljahrsblätter. Ob das als katholisch geprägt geltende Bonner Institut damit seine Linientreue unterstreichen wollte? Den beiden Zenderförderern und Parteigenossen Bach und Naumann dürfte dies auch so gefallen haben. Sieht man die Beiträge der Rheinischen Vierteljahrsblätter ab 1933 durch, dann spielt die „Westforschung“ weiterhin eine große Rolle. Franz Petri setzte sich ausführlich mit Henri Pirennes (1862-1935) belgischer Geschichte auseinander und lieferte einen umfangreichen Literaturbericht zur belgisch-niederländischen Geschichte, Franz Steinbach reflektierte über die Entstehung der Volksgrenze und der Staatsgrenze zwischen Deutschland und Frankreich. Und im Oktoberheft 1934 veröffentlichte Matthias Zender, als ob nichts geschehen wäre, einen kleinen Aufsatz „Wallfahrten bei Fallsucht und Krämpfen.“ (163)
Was jedoch bei dem Aufsatz „Wandlungen im Bauerntum der Westeifel“ weiter auffällt, sind die Schwächen der Analyse. Zenders spätere Arbeiten, etwa zum Deutschtum in Arlon, bestechen durch eine umfassende Literaturkenntnis, das umfangreiche Heranziehen von statistischem Material und eingehende Feldbeobachtung vor Ort. Hier greift er auf seine Erzählforschungen zurück, ohne auch nur die Frage anzuschneiden, in welchem Zusammenhang Märchen und Sagen mit der Arbeits- und Lebenswelt der Zuhörer standen. Und er fasst eine Reihe subjektiver Eindrücke zusammen, mit denen er die Vorurteile seiner Zuhörer bedienen will: Die Welt ist schlecht, die Stadt ist ganz schlecht, und die Situation des Bauerntums wird immer schlechter. Den Bevölkerungsanstieg des 19. Jahrhunderts interpretiert Zender als Hinweis auf die Fruchtbarkeit des Bauerntums, die Pauperismuskrise als Folge von Aufklärung, Liberalismus und Kapitalismus, die Abwanderung in die Großstädte wird als Faulheit und Materialismus verunglimpft und die Amerikaauswanderung als „Psychose“ abgestempelt (164). Holzschnittartig wird die gute alte Zeit der intakten Familien-, Nachbarschafts- und Dorfstrukturen einer trostlosen Gegenwart gegenübergestellt. Weder die Ursachen der Krise der Bauernkultur werden vernünftig herausgearbeitet noch die Veränderung in Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft. Dem entspricht das Fehlen einschlägiger Literatur, man vermisst sowohl den fundierten Aufsatz über die Eifelbauern in der Eifelvereinsfestschrift von 1913 als auch den zur Agrargeschichte in der Geschichte der Rheinlande von 1920. Emil Meynens (1902-1994) landeskundliches Buch über das Bitburger Land von 1928, Raimund Fausts Bauernvereins-Festschrift „Die wirtschaftlichen Kämpfe des deutschen Bauernstandes in den letzten 50 Jahren“, das die Bedeutung des Zender weitgehend unbekannten Genossenschafts- beziehungsweise Vereinsgedankens hervorhebt, fehlt ebenso wie Erich Spenglers Dissertation über den Trierer Bauernverein von 1930, die bemerkenswerte Analysen zur Lage der Landwirtschaft enthält.
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts setzte in der Eifel ein Strukturwandel ein, der 1934 noch längst nicht abgeschlossen war, der durch verbesserte Verkehrsanbindung, neue Züchtungs- und Anbaumethoden (Kunstdünger!) und vor allem auch – wie von Zender gefordert – bessere Berufsausbildung die landwirtschaftliche Produktion und damit auch das Landleben nachhaltig veränderte (165). So war 1847 eine Landwirtschaftliche Lehranstalt in Bonn ins Leben gerufen worden, die 1934 (!) in eine landwirtschaftliche Hochschule umgewandelt wurde und über Wanderlehrer, landwirtschaftliche Vereine und Landwirtschaftsschulen – wie bereits 1873 in Bitburg, wo Zender referierte (166) –, die Ausbildung der Landwirte verbesserte (167). Der Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen, vor dem Zender 1932 seinen Vortrag hielt, wurde 1934 aufgelöst beziehungsweise gleichgeschaltet. Als er 15 Jahre später wiederbegründet wurde, traten ihm 254 Ehemalige bei, was die Bedeutung der Bitburger Landwirtschaftsschule nachdrücklich unterstreicht (168). Man muss Zender hier kritisieren, weil er den Strukturwandel grundsätzlich negativ sah und die Chancen, die sich für eine Region und ihre Bewohner ergaben, gar nicht sah oder sehen wollte (169).
Und noch an einer anderen Stelle müssen wir unsere bisherigen Überlegungen relativieren: Der 1888 von dem nationalliberalen Gymnasialdirektor Dr. Adolf Dronke (170) in Trier gegründete Eifelverein hatte sich die Förderung der Wirtschaft in der Eifel, zunächst auch der der Fischzucht, dann aber vor allem des Tourismus, zum Ziel gesetzt (171). Die Gründung des Eifelvereins war dabei eine Reaktion auf die Gründung des Trierischen Bauernvereins im Jahre 1884, also mitten im Kulturkampf, ein Werk des „Presskaplans“ (Gründer des Paulinus und der Trierischen Landeszeitung) und Sozialreformers Georg Friedrich Dasbach (1846-1907) (172). Der Verein strebte eine „geistige, soziale und wirtschaftliche Hebung und Erhaltung des Bauern- und Winzerstandes nach den Grundsätzen des positiven Christentums unter strenger konfessioneller und parteipolitischer Neutralität“ an. Freilich war die überwiegende Mehrheit seiner Mitglieder katholisch und aufs engste mit dem Kreis der Reichstags- und Landtagsabgeordneten des Zentrums verflochten. Der TBV betrieb eine erfolgreiche Lobbyistenpolitik im Bereich der Agrargesetzgebung und konnte durch die Gründung von Genossenschaften und einer landwirtschaftlichen Bank, durch Auskunfts- und Beratungsbüros, Rechtsberatung und Prozesshilfe sowie Viehversicherungen viel für die Landwirtschaft tun, wobei er vom preußischen Staat kritisch beäugt wurde. Der „Presskaplan“ begründete zudem 1887 einen „Trierischen Bauernkalender“ und 1892 als Vereinszeitschrift den „Trierischen Bauern“, der 1909 eine Auflage von 28.500 Stück erreichte. 1907 hatte der TBV 829 Ortsvereine mit 23.960 Mitgliedern, 1914 waren es bereits 36.074, also deutlich mehr als der Eifelverein, dessen größeren Ortsgruppen zudem in den großen Städten am Rande der Eifel (Aachen, Köln, Bonn, Koblenz, Trier) angesiedelt waren (173). Es gibt also auch hier eine Kluft zwischen den Darstellungen der Bauern, der Dörfer und der Landschaft in der Eifel und in der Mitgliederzeitschrift „Die Eifel“.
Überspitzt formuliert, erlebten die in den Großstädten am Rande und in den Klein- beziehungsweise Mittelstädten der Eifel (Bitburg, Prüm, Gerolstein, Daun, Wittlich Mayen) lebenden Mitglieder des Eifelvereins, die überwiegend als Beamte, Kaufleute und Unternehmer tätig waren, dieses unfruchtbare Mittelgebirge überwiegend am Wochenende als Wanderer und dann noch einmal als Leser der „Eifel“ und des Eifelkalender, in denen die Schönheit der Landschaft beschworen wurde und die gute alte Zeit in Bildern und Texte ihre Auferstehung feierte. Matthias Zender lebte seit 1919 nicht mehr in der Eifel, sondern in Trier und in Bonn, und zwar als Gymnasiast, Student, dann als „wissenschaftlicher Hilfsarbeiter“, Assistent und schließlich als Professor. Die Eifel kannte er vor allem durch Verwandtenbesuche am Wochenende, sie war für ihn der verklärte Ort seiner Kindheit und seiner Doktorandenzeit, bevölkert von den Gestalten der Sagen und Märchen, von Feen, Zauberern, Hexen und Zwergen. Von den Problemen der landwirtschaftlichen Produktion, die sich in den 1920er und 30er Jahren gravierend veränderte und in den 50er, 60er und 70er Jahren durch die europäische Agrarpolitik geradezu industrielle Formen und Ausmaße annahm, hatten beide keine vertiefte Sachkenntnis. Sie nahmen allenfalls die Veränderungen der dörflichen Arbeits- und Lebenswelt wahr und deuten sie als Verlust der guten alten Zeit. Dies muss man berücksichtigen, wenn man Zenders Aufsätze oder die Veröffentlichungen des Eifelvereins als Quelle auswerten will.
3.7 Zenders Literaturliste
Man fragt sich, wieso dieser Aufsatz in den Rheinischen Vierteljahrsblättern überhaupt veröffentlicht wurde. Seine bescheidene Qualität zeigt sich bereits bei den Formalia: Es handelt sich um ein Vortragsmanuskript, bei dem in der ersten Fußnote Ort und Anlass genannt werden und in der zweiten ein Kurztitel, der in der dritten aufgelöst ist, und zwar gleich doppelt; hier findet sich zudem eine kurze Auswahlbibliographie, in die wir einen Blick werfen sollten.
An erster Stelle nennt Zender den Aufsatz von Heinrich Getzeny (1894-1970) „Was geht in unserem Bauerntum vor“, der in der katholisch geprägten Monatsschrift „Hochland“ erschien (174). Getzeny war Landessekretär des Volksvereins für das katholische Deutschland in Württemberg. Neben historischen und kunsthistorischen Publikationen veröffentlichte er 1932 ein Buch über „Kapitalismus und Sozialismus im Lichte der neueren, insbesondere der katholischen Gesellschaftslehre.“ Sein Aufsatz geht allerdings in eine andere Richtung als Zenders Hinweise vermuten lassen: Zwar besitzt er einen mittleren Teil, in dem er die mentalen und kulturellen Veränderungen der Gegenwart kritisch beurteilt. Aber der Artikel beginnt zunächst mit einer präzisen Analyse der Zoll- und Steuerpolitik und ihrer Folgen für die Landwirtschaft. Er enthält aber auch den deutlichen Hinweis, dass sich die Bauern auf die geänderte Nachfrage nach Qualitätsprodukten einstellen müssten: Die Produktion sollten sie steigern und verbessern, den Absatz besser organisieren und zu einer kaufmännischen Betriebsführung übergehen. Motorkraft und Elektrizität seien „ein Segen.“ Vor allem müsse man unbedingt angemessene landwirtschaftliche Bildungseinrichtungen schaffen.
Anschließend druckt die Redaktion eine namentlich nicht gekennzeichnete Leserzuschrift ab, in der die „ungeheuerliche Verschwendung an Rohstoffen, Fertigerzeugnissen und Arbeitskraft“ durch unprofessionelles Wirtschaften beklagt wird. „Aber der Bauer will nicht; er sieht nicht einmal, worauf es ankommt.“ Dann zitiert der Verfasser eine Gutspächterin aus der Gegend von Aachen: „Nein, mein Sohn braucht die landwirtschaftliche Schule nicht zu besuchen. Der kann arbeiten. Sehen sie einmal, wie der Holz hacken kann.“ Nachdem der Verfasser anhand von Statistiken den erschreckend dürftigen Besuch der landwirtschaftlichen Schulen insbesondere auch durch die „weibliche Landjugend“ festgestellt hat, spricht er „von einer schweren Mitschuld der Landwirte an ihrer Notlage.“
Als weitere Literaturhinweise nennt Zender zwei Bücher des Agrarromantikers und NS-Ideologen Walther Darré 1895-1953), „Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse“ (1929) und „Neuadel aus Blut und Boden“ (1930). Darré, der von einer vormodernen Ständegesellschaft mit vorindustriellen Produktionsformen träumte, stieß nach seinem Abschluss als Diplomlandwirt zum Umfeld Heinrich Himmlers (1900-1945). Mit dieser Schrift wurde Darré zum Chefideologen der NS-Agrarpolitik. Er behauptete, für die Weltwirtschaftskrise und den Untergang der Weimarer Republik seien jüdisch-bolschewistische und jüdisch-kapitalistische Verschwörungen verantwortlich. Er forderte eine geistige und rassische Erneuerung durch eine Abkehr von der Industrie und eine Hinwendung zur Landwirtschaft. Der Bauer sollte in einer neuen Ordnung wieder zu einem ersten Stand werden. Seit 1930 war er agrarpolitischer Berater Hitlers und leitete ab 1931 das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS (175).
Als vierten Titel nennt Zender das Büchlein „Das Landvolk. Ein soziologischer Versuch“ (1933) des in Königsberg lehrenden Soziologen, Philosophen und Bevölkerungswissenschaftlers Gunther Ipsen (1899-1984). Dieser stand der NS-Ideologie nahe und veröffentlichte 1933 ein weiteres Buch über „Blut und Boden.“ Das genannte Werk stellt den Versuch dar, die Kategorie „Landvolk“ soziologisch herauszuarbeiten, indem sie dem Stadtvolk und dann dem Bauern, dem Hof und dem Dorf gegenüber gestellt wird.
„Jungbauer erwache“ ist der kämpferische Titel einer Schrift von Anton Heinen (1869-1934), die 1924 und in zweiter Auflage 1926 erschien. 1933 folgte „Der Jungbauer und seine Ehre.“ Heinen war Kaplan und Lehrer und leitete ab 1914 die Abteilung Volksbildung an der Zentralstelle des Volksvereins für das katholische Deutschland in Mönchengladbach und ab 1932 das Franz-Hitze-Haus in Paderborn, weiter war er Pfarrer im niederrheinischen Rickelrath (Stadt Wegberg). Heinen war der führende Vertreter einer katholischen Volksbildung, er strebte eine Einheit von Religion und Volkstum an. In einer Vielzahl von erbaulichen, oft in Dialogform abgefassten Aufsätzen und Büchern sprach er ein breites Publikum an (176). Sein Büchlein an den Jungbauern ist wesentlich weniger kämpferisch als es der Titel erwarten lässt. Es enthält zum Beispiel ein beschauliches Kapitel, ob das Gemeinschaftsleben den Pastor etwas angehe, und es diskutiert die Frage „Bauernknecht oder Industriearbeiter.“ Mit gutem Willen und einer guten Ausbildung könne man auch auf dem Lande durchaus seinen Weg machen. Wie bei Getzeny wird der Begriff der „Heiligen Scholle“ erörtert. „Der Bauer in der Stadt“ bekommt gute Ratschläge, keine Minderwertigkeitsgefühle aufkommen zu lassen, seine Tracht und kein geschmackloses Modekostüm zu tragen, bei Polizisten, Postbeamten und Straßenbahnschaffnern nach seriösen Lokalen zu fragen oder, noch besser, in ein Museum oder eine Kirche zu gehen. Auch der Städter, der als „Wandervogel“ mit „Zupfgeige und Kochgeschirr“ aufs Land kommt, wird mit Verhaltensregeln bestens versorgt.
Das nächste Buch stammt von A. l‘Houet „Zur Psychologie des Bauerntums“ (1933). A[lbert] l’Houet ist ein Pseudonym für Dr. Wilhelm Borée (1862-1945), der von 1894 bis 1932 Pfarrer in Stuhr-Heiligenrode bei Bremen war (177). Sein Buch endet mit dem Kapitel „Akute Vergiftung. Praktischer Ausblick“, das mit der Feststellung beginnt: „Deutschlands Bauerntum geht unter!“ Die „erdgeborene, ländliche Aristokratie“ steige ab zur „zweifelhaften Stadtexistenz, zum Kulturproletariat.“ Schon im Mittelalter hätten die Herrscher die Landflucht begünstigt, jetzt ströme die Landbevölkerung in die „Unnatur der Fabrikverhältnisse“. Die Stadt „vergiftet und infiziert“ den Bauernstand. Die Militärärzte würden den schlechten Gesundheitszustand der Fabrikarbeiter beanstanden, aber die „Entartung“ betreffe auch den religiösen und moralischen Bereich. Man brauche das Bauerntum als „Brotquelle“, vor allem sei es ein großer „Vorrat physischer, geistiger, moralischer und religiöser Jugend und Gesundheit eines Volkes.“
Die Erstauflage von Borées Buch stammt von 1905, die zweite von 1920. 1935 erschien eine neu bearbeitete Auflage, deren Vorwort mit dem Wort „Endlich“ beginnt. Vor 1933 habe sich niemand um das Bauerntum gekümmert. „Der Bauer war von allen Ständen und Berufen der am wenigsten verfahrene. Ein paar Griffe, etwas weniges Geld, und er war wieder in Ordnung. Und unsere Industrie … ist froh, ihre Leute in den Stand, aus dem sie sie einst in ihren Glanz hineingezogen hat, zur Heilung wieder abgeben zu können, zur Heilung von Wunden, die sie selbst geschlagen hat.“
Als nächstes nennt Zender Gerhard Löwenkamps Buch „Bauernschulung. Bildungsprobleme des Bauernstandes“ (1930). Löwenkamp war Generalsekretär des Bauernvereins und Geschäftsführer des in Niedersachsen tätigen Vereins „Bauernschulung“ zur Pflege und Förderung bäuerlicher Kultur (178). Löwenkamp möchte den Bauernstand durch verbesserte Bildungsmöglichkeiten erhalten. Hervorzuheben ist das einführende Kapitel über „Die volkspolitische Bedeutung des deutschen Bauernstandes.“ Hier wird die Bedeutung des Bauern für die Volkswirtschaft, die Volksbiologie und die Volkskultur unterstrichen. Das Bauerntum ist „Kulturfaktor für das gesamte Volk.“ Zwar sei der Bauernstand „noch gesund“, aber „Anfänge zu Veränderungen“ seien erkennbar: „Der Einbruch erfolgte von der ökonomischen Seite her.“ Weiter folgert er: „Bauernwirtschaft und kapitalistischer Geist schließen sich aus. Wo der Kapitalismus anfängt, hört der Bauer auf.“ Sein Schreckensbild ist „der amerikanische Farmer mit Telefon, Fordwagen und Bankkonto.“
Das nächste Buch stammt von dem in Münster lehrenden Kirchenhistoriker und Volkskundeforscher Georg Schreiber (1882-1963), der ab 1920 für das Zentrum im Reichstag saß und 1927 eine Forschungsstelle für Auslandsdeutschtum und Auslandskunde gründete. Er gilt als einer der wichtigsten Kulturpolitiker seiner Zeit (179). Sein Buch „Nationale und internationale Volkskunde“ erschien 1930 in der von ihm herausgegebenen Reihe „Forschungen zur Volkskunde.“ In dem Kapitel „Realistische und pessimistische Volkstumsbewertung“ sieht er durchaus Krisenerscheinungen, aber auch vielversprechende Neuanfänge: In der Holzschnitzerei, in der Krippenkunst und bei den Volksliedern. „So sprudelt neues Volkstum aus uralten Tiefen. Und Volkskunde ist keineswegs eine sentimentale Flucht aus verarmter Gegenwart in eine reichere Vergangenheit.“ Weiter führt er Soldatenlieder an, die Arbeiter-, die Jugend- und die Wanderbewegung, Laientheater und Volkstanz. „Bei allen Verlusten wird die Freude darüber bleiben, daß das Volkstum … sich immer wieder aus eigenem Mutterboden ergänzt. So bleibt die Volkskunde eigentlich eine frohe und fröhliche Wissenschaft.“
Auch das Kapitel „Volkstum und Bauerntum“ konstatiert durchaus einen „Zerfall des ursprünglichen Volkstums, eine gewisse geistige Verödung auf dem Lande, die … Landflucht, die Krise der Agrarwirtschaft, Übersteigerung des kapitalistischen Moments.“ Dennoch seien „starke Volkstumsreserven vorhanden.“ Er schätzt die kulturelle Leistung des Bauerntums, will aber auch „die beachtlichen Volkstumswerte der Stadt nicht unterschätzen.“ Er erkennt auch in der Wissenschaft eine „Rückeroberung des Landes“ – Volkstrachten, Flurnamen und Bauernhäuser. Von den zahlreichen Autoren nennt er unter anderem Heinen und Weigert. Abschließend betont er nochmals die Bedeutung der volkskundlichen Forschung, die „für die Psychologie des Landes und für das Begreifen seiner Kulturkraft“ unerlässlich sei. Gerade in krisengeschüttelten Regionen wie der Eifel und Ostpreußen würde sie „unmittelbar auch der inneren Festigung des deutschen Bauerntums dienen.“ Dann nähert er sich langsam Zender: Die Krisenerscheinungen wie „Massenflucht in die Stadt“, das „Eindringen slawischer Arbeitermassen“ etc. kämen nicht nur von außen, es gäbe auch „eine innere Auflockerung der ‚Not- und Tatgemeinschaft‘, die das dörfliche Leben der Gegenwart kennzeichnet.“ Hier wird eine „Kulturpolitik des Landes“, nicht nur der Stadt gefordert. Das anschließende Kapitel ist der „Volkskunde der Groszstadt“ gewidmet, die er zu einer Heimatstadt machen möchte. Gefordert wird eine Volkskunde des Industriearbeiters, aber auch der anderen Gruppen der Stadtbevölkerung.
Der letzte Autor auf Zenders Literaturliste ist Joseph Weigert (1870-1946), der von 1900 bis 1931 Pfarrer, Bauer und Schriftsteller im oberpfälzischen Mockersdorf war. Seine oft in mehreren Auflagen erschienen Werke kreisten um das Thema Leben auf dem Lande, zum Beispiel: „Treu deiner Scholle – treu deinem Gott“ (1920), „Bauer, es ist Zeit“ (1920), „Die Volksbildung auf dem Lande“ (1924), „Religiöse Volkskunde“ (1924), „Bauernpredigten“ (1924), „Heimat- und Volkstumspflege“ (1925) und: „Die weibliche Jugend auf dem Lande“ (1931). Der „Untergang der Dorfkultur“ (1929, 2. Auflage 1930) befasst sich mit dem Unterschied zwischen Stadt und Land, der alten und der heutigen Dorfkultur, und den Fragen, ob die alte Dorfkultur heute noch einen Wert habe und ob man die heutige erneuern solle. Für die Gegenwart stellt er eine „Verödung des Landlebens“ durch den Niedergang der Institutionen Verwandtschaft, Nachbarschaft und Wirtschaft fest. „Eine saubere Bauernstube mit Herrgottswinkel, kräftig-derber, bunter Einrichtung mit hübschen Bildern sollte die Hausgenossen ans Heim fesseln.“ Bücher sollte man (vor)lesen, Handarbeiten machen und Theaterstücke aufführen. Er erkennt aber durchaus auch die „Lichtseiten der heutigen Dorfkultur.“ Freilich müsse der Bauer beachten, dass Stadtkultur eben keine Bauernkultur sei, man könne sie auch nicht vom Lande fernhalten. Dann kommt er zu dem Fazit: „Der Kern des Bauerntums wird bleiben.“ Denn: „Es kann sein, daß die anderen Volksschichten noch ihre Zuflucht beim Bauern nehmen.“
Zenders Literaturliste ist eine bunte Mischung aus soziologischen, psychologischen, agrarwissenschaftlichen und volkskundlichen Arbeiten, beschaulichen katholischen Erbauungsschrifttums und Büchern des NS-Ideologen Walther Darré. Dessen Blut-und Boden-Mystik übernimmt er zwar nicht, aber Agrarromantik, Städtefeindschaft und die Kritik an Liberalismus und Kapitalismus finden sich auch bei ihm. Freilich war Darré nicht eben originell, und vergleichbare Gedanken finden sich auch bei anderen hier genannten Autoren. Ähnliches kann man auch Zender bescheinigen, er greift recht unkritisch eine Reihe von Analysen, Deutungen und Vorschlägen auf, die in dieser Zeit populär waren und die auch in Darrés Bücher Eingang gefunden haben. Dies gilt zum Beispiel für die Sicht des Bauerntums als Ernährer der Stadt, als Lieferant gesunder Neubürger und als Gesundheitsbrunnen für alle physischen und psychischen Erkrankungen, die die Stadt verursacht hat. Einige Autoren sahen das Verhältnis zwischen Stadt und Land sachlicher und neutraler. Getzeny, Heinen, Löwenkamp und Weigert maßen der Bildung einen hohen Stellenwert bei, ebenso Zender, der freilich Getzenys scharfe Analyse und seinen weitgehenden Ratschlägen zur Selbstverantwortung nicht folgte und sich lieber wie Borée auf das neue Regime verließ.
3.8 Versuch einer Wertung und der Kontext der NS-Agrarpolitik
Wie soll man Zenders schlecht recherchiertes und populistisches Pamphlet, mit dem er freudig die neuen Machthaber begrüßte und das in einer renommierten landeskundlichen Fachzeitschrift erschien, einordnen? Man kann das Ganze als Jugendsünde bezeichnen, und zwar in zweierlei Hinsicht: Da wurde einem 25-jährigen Studenten und Doktoranden die Möglichkeit geboten, in der Kreisstadt seiner Heimat einen öffentlichen Vortrag zu halten. Zender stellte seine Forschungen zu den Sagen und Märchen der Eifel in den Mittelpunkt und sah in ihnen eine Quelle zur Rekonstruktion der guten, alten, bäuerlichen Welt, die er durch den Fortschritt und den schlechten Einfluss der Stadt bedroht sah. Das war es, was seine Zuhörer hören wollten. Damit wäre es gut gewesen, wenn Zender nicht ein Jahr später den Vortrag noch einmal in die Hand genommen hätte. Er studierte die Schriften der NS-Ideologen zur Landwirtschaft und glaubte, darin ein Bekenntnis zu seinen Idealen zu erkennen, wobei selbst Darré später an den Widersprüchen zwischen seiner Agrarpolitik und denen der Aufrüstung für den Krieg scheiterte.
Weiter muss man vorausschicken, dass Zenders Aufsatz kulturpessimistische Strömungen widerspiegelt, die in der Literatur, Kunst, Publizistik und Wissenschaft nicht nur der 1930er Jahre eine große Rolle spielten. Es waren nicht nur der verlorene Krieg und seine Folgen, die hier zum Ausdruck kamen, sondern auch der Strukturwandel im Gefolge der Industrialisierung, der zunehmend auch die ländliche Arbeitswelt veränderte. Dies wurde als Untergang der „guten alten Zeit“ überwiegend negativ konnotiert. Hinzu kam eine negative Beurteilung des Stadtlebens und der Moral seiner Bewohner, die sich aber bereits bei mittelalterlichen Autoren und in der Aufklärung findet (180).
Vor allem drei Autoren sind hier zu nennen, zunächst der Volkskundler Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1897), der in seiner „Naturgeschichte des deutschen Volkes als Grundlage einer deutschen Socialpolitik“ (1851-1869) die zunehmende Verstädterung und Industrialisierung aus der Perspektive der städtefeindlichen Agrarromantik negativ beurteilte. Weiter ist der Geschichtsphilosoph Oswald Spengler (1880-1936) anzuführen, dessen „Untergang des Abendlandes“ (1918, 1922) den Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts in ein Krisenbewusstsein überleitete. Spengler verwendete erstmals das Begriffspaar von Blut (im Sinne von Abstammung) und Boden (als landwirtschaftliche Fläche, aber auch als Lebensraum), das dann durch Walther Darré in seinem Buch „Neuadel aus Blut und Boden“ (1930) zu einem zentralen Begriff der NS-Ideologie wurde (181).
Am 28.4.1933 übernahm Darré den Vorsitz der Reichsführergemeinschaft der landwirtschaftlichen Verbände, am 28.5.1933 wurde er zum Reichsbauernführer berufen und am 29.6.1933 Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft. Neben dem (Reichs-)Amt für Agrarpolitik leitete er den Reichsnährstand, in dem die gleichgeschalteten Organisationen nicht nur der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, in der Fischerei und im Gartenbau, sondern auch alle im Handel mit Lebensmitteln Beschäftigen organisiert waren. In der „Reichsbauernstadt“ Goslar wurden „Reichsbauerntage“ und auf dem Bückeberg bei Hameln „Reichserntedankfeste“ veranstaltet, die über eine Million Teilnehmer anzogen. Am 29.9.1939 wurde das Reichserbhofgesetz verkündet, welches „das Bauerntum als Blutquelle des deutschen Volkes“ erhalten“ sollte. Stolz bezeichnete Zender bei der Anzeige seiner Heirat seinen Schwiegervater Johann Baptist Neyses als „Erbhofbauer“ in Meckel (182). Nicht nur das Reichserbhofgesetz, sondern auch das Reichserntedankfest lobte er wie die Feiern zum 1. Mai und die Sonnwendfeiern als vielversprechenden Neuanfang im Bereich des bäuerlichen Brauchtums (183).
Freilich konnte er noch nicht absehen, dass dieses christliche Fest politisch instrumentalisiert und im Sinne einer Wotansverehrung germanisiert wurde (184).
Darrés agrarromantische Vorstellungen kollidierten bald mit den Aufrüstungsplänen des „Dritten Reichs“. Noch 1936 veröffentlichte er das Buch „Blut und Boden, ein Grundgedanke des Nationalsozialismus“ (185). Nach der Verkündung des Vierjahresplans kam es 1936 zu Auseinandersetzungen mit Hermann Göring (1893-1946) und Hjalmar Schacht (1877-1970). Hinzu traten massive Kompetenzstreitigkeiten mit der NSDAP und der Deutschen Arbeitsfront sowie mit einigen Gauleitern. Nach Konflikten mit Himmler über die Siedlungspolitik wurde Darré 1938 als Leiter des Rasse- und Siedlungshauptamtes entlassen und trat als Minister bis zu seiner endgültigen Absetzung 1942 in den Hintergrund. Darré konnte die Landflucht nicht beenden, weil Autobahnbau, Westwall und Rüstungsindustrie so attraktive Arbeitsplätze boten, dass sie 400.000 Landarbeiter anzogen; Erntehelfer aus HJ und BDM konnten das nicht ausgleichen. Verschwiegen wird von den genannten Autoren jedoch stets, wie katastrophal die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Landarbeiter waren, die sich durch den Reichsnährstand auch nicht verbessern sollten. Auch die landwirtschaftliche Produktion ließ sich nicht in dem Maße steigern, dass das „Dritte Reich“ von Importen unabhängig wurde. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges sah die Landwirtschaft in jedem Fall ganz anders aus, als es sich Darré und sicherlich auch Zender vorgestellt oder gar gewünscht hatten.
Mit seiner grandiosen Fehleinschätzung der neuen Verhältnisse stand Zender im katholischen Lager nicht allein: Im Januar 1933 bewegte die Trierer Katholiken die Ankündigung einer Wallfahrt zum Heiligen Rock weitaus mehr als der neue Reichskanzler. Am 6. Januar hatte Papst Pius XI. (Pontifikat 1922-1939) anlässlich der 1900-jährigen Wiederkehr des Kreuzestodes Christi ein Heiliges Jahr ausgerufen. Am 25. Januar wurde bekannt gegeben, dass vom 23. Juli bis zum 3. September der Heilige Rock ausgestellt werden sollte. Am 30. Januar, einen Tag vor der „Machtergreifung“, veröffentlichte man dies im Kirchlichen Amtsanzeiger. Am 20.7.1933 wurde außerdem das Reichskonkordat unterzeichnet, von dem man sich auf katholischer Seite die Lösung aller offenen Fragen zwischen Kirche und Staat erhoffte.
Mit seiner grandiosen Fehleinschätzung der neuen Verhältnisse stand Zender im katholischen Lager nicht allein: Im Januar 1933 bewegte die Trierer Katholiken die Ankündigung einer Wallfahrt zum Heiligen Rock weitaus mehr als der neue Reichskanzler. Am 6. Januar hatte Papst Pius XI. (Pontifikat 1922-1939) anlässlich der 1900-jährigen Wiederkehr des Kreuzestodes Christi ein Heiliges Jahr ausgerufen. Am 25. Januar wurde bekannt gegeben, dass vom 23. Juli bis zum 3. September der Heilige Rock ausgestellt werden sollte. Am 30. Januar, einen Tag vor der „Machtergreifung“, veröffentlichte man dies im Kirchlichen Amtsanzeiger. Am 20.7.1933 wurde außerdem das Reichskonkordat unterzeichnet, von dem man sich auf katholischer Seite die Lösung aller offenen Fragen zwischen Kirche und Staat erhoffte.Um dem unerwarteten Ansturm von zwei Millionen Pilgern Herr zu werden, nahm die Wallfahrtsleitung dankend das Hilfsangebot von SA und „HJ an. Die Wallfahrt wurde für die neuen Machthaber zu einem ungeheuren Propagandaerfolg. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Belgien und Luxemburg berichteten die Pilger, wie freundlich und hilfsbereit die Männer in den braunen Uniformen waren (186). Auch Teile des deutschen Klerus waren verblendet. Erschüttert liest man heute die offizielle Abschlusspublikation zur Wallfahrt aus der Feder des bekannten Kunsthistorikers und Domkapitulars Nikolaus Irsch (1872-1956), der von einem neuen Bündnis von Thron und Altar träumte, vom gemeinsamen Kampf gegen Kommunismus und Bolschewismus, und der die Blutfahne der SA, mit der Standarten berührt wurden, mit dem Heiligen Rock verglich (187). Doch wenig später begann der Kirchenkampf mit der Bekämpfung der Jugendarbeit, der Überwachung und Verfolgung vieler Priester, der propagandistisch weidlich ausgenutzen Prozesse um Sittlichkeitsdelikte und Devisenschiebereien, und die Nachbarn im Westen merkten spätestens 1939, dass sie getäuscht worden waren (188).
Insofern würde ich Zenders Aufsatz als eine Jugendsünde, als einmalige Entgleisung bezeichnen, die ohne Fortsetzung blieb und von der sich seine weiteren Arbeiten deutlich und wohltuend unterschieden. Er hat sich später auch insofern von ihm distanziert, als er in der Einleitung der Neufassung von 1955 berichtet, er habe über dieses Thema bereits vor über 20 Jahren unter dem Titel „Wandlungen in der bäuerlichen Kultur“ vor den Studenten Adolf Bachs referiert.“ (189) Die ebenfalls in den Rheinischen Vierteljahrsblättern erschienene Neufassung besitzt zunächst einmal eine ganz andere wissenschaftliche Qualität als die Erstfassung; auch die sprachliche Form ist wesentlich gediegener. Dann sind sämtliche Anklänge an das „Dritte Reich“ und seine Ideologien getilgt, die Kritik an der Stadt wird deutlich gemildert, die Analyse ist wesentlich fundierter und schärfer.
Geblieben sind freilich der kulturpessimistische Zug und die Tendenz zur Agrarromantik, die Verklärung der guten alten Zeit, in der man nach der Feldarbeit gemeinsam singend nach Hause zog. Geblieben ist auch die Verknüpfung eines wirtschaftlichen und sozialen Wandels mit einer geistigen und mentalen Krise. Freilich hat Zender aus dieser Veröffentlichung für seine weiteren Arbeiten zwei Konsequenzen gezogen: Erstens ging er selbst bei seinen durchaus brisanten Forschungsarbeiten der späten 1930er Jahre vollständig auf Distanz zur Politik. Und zum Zweiten beschränkte er sich fortan auf die Analyse der historischen Dimension von Wandlungsprozessen. Weder gab er Prognosen für die weitere Entwicklung noch Ratschläge, wie man diese gestalten sollte. Schließlich blieb auch die kulturpessimistische Betrachtungsweise nicht ohne Folge: Zender glorifizierte in seinen Arbeiten die gute alte Zeit, er sah den Wandel als Zerstörung und Verlust, und er erkannte nicht die Vorteile und Perspektiven dieser Veränderungen. Die 1934 und 1955 gehegten Hoffnungen auf eine neue Bauernkultur blieben Illusion. Nach 1955 haben sich die Landwirtschaft und das Dorfleben so tiefgreifend verändert, wie es Zenders Generation nie für möglich gehalten hätte.
Mit einer quellenkritischen Bemerkung sollen diese Überlegungen abgeschlossen werden: Matthias Zender gilt als der überzeugende Repräsentant des tief in der Tradition und im katholischen Glauben verwurzelten Eifeler Bauerntums. Gewiss, er war Zeit seines Lebens immer wieder in Niederweis und wählte dort auch seine letzte Ruhestätte. Aber er lebte, wie bereits angesprochen, seit 1919 in Trier und seit 1926 in Bonn, unterbrochen von kurzen Aufenthalten in seiner Studentenzeit, im Krieg und nach dem Krieg. Gewiss, er war ein brillanter Kenner und Beobachter der bäuerlichen Welt, aber er war ein Stadtmensch geworden, ein höherer Beamter, der das Landleben als Zuschauer, Beobachter und Gast erlebte.
Insofern kommt Zender zu einer gänzlich anderen Sicht der Dinge als der 1929 in dem zwischen Vianden und Bitburg gelegenen, nur 23 Kilometer von Niederweis entfernten Niederraden geborene Johannes Nosbüsch (1929-2011). Dieser fügte 1993 beziehungsweise 2001 seine Kindheitserinnerungen aus den späten 1930er Jahren in theologische und philosophische Konzepte ein und entwickelte daraus eine persönlich gefärbte Modernisierungstheorie der Eifel. Nach seinem Abitur 1948 schlug er ebenfalls eine universitäre Laufbahn ein (190).
Eine gänzlich andere Sicht entwickelte der ebenfalls aus einer Bauernfamilie im Bergischen Land stammende Franz Steinbach, der sich Zeit seines Lebens für die Agrargeschichte interessierte. Um nur wenige Beispiele herauszugreifen: 1922 promovierte er mit „Beiträgen zur Bergischen Agrargeschichte. Vererbung und Mobilisierung des ländlichen Grundbesitzes im bergischen Hügelland.“ 1931 veröffentlichte er einen Aufsatz über „Das Bauernhaus der westdeutschen Grenzlande“ und 1933 publizierte er in Luxemburg einen Vortrag über „Bauernhaus und Bauernkultur.“ (191) Nach seiner Emeritierung veröffentlichte Steinbach 1963 einen in mehrfacher Hinsicht peinlichen Artikel „Bürger und Bauer im Zeitalter der Industrie.“ (192) Der Aufsatz selbst entfaltet ein zeitlich und thematisch weit gespanntes Panorama des Verhältnisses von Stadt und Land vom Mittelalter bis in die Gegenwart, wo auch die „erbbiologischen Verhältnisse im Bauernstand“ nicht fehlen dürfen. Aus hygienischen, sanitären und kulturellen Gründen gebe es ein „zivilisatorisches Zurückbleiben“ der Landbevölkerung. Dies gelte auch für die Bildung und die Schriftlichkeit, vor allem aber für die „Anhänglichkeit an alle vom Schweiß der eigenen Vorfahren gedüngten Grundstücke.“ Dies werde in der Volkskunde und Dichtung als typisch bäuerliche Tugend verherrlicht. Detailliert wird der technische Wandel seit dem späten 19. Jahrhundert herausgearbeitet und festgestellt, dass sich durch Auto, Zeitungen, Radio, Fernsehen und Wochenendhäuser der Abstand zwischen Stadt und Land verringert habe. Die Analysen zum Strukturwandel in der ländlichen Gesellschaft und die Vorschläge der Experten werden bezüglich ihrer Finanzierbarkeit und ihrer Erfolgsaussichten kritisch beurteilt. Die Landflucht sowie die sinkende Zahl der Arbeitsplätze in der Landwirtschaft wird als „notwendig und nützlich“ beurteilt und würde zudem die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten steigern. Ohne auf Steinbachs Äußerungen im Einzelnen eingehen zu könne, sei festgehalten, dass er die Veränderungen der ländlichen Arbeitswelt wesentlich präziser beobachtete als Zender, dass er sich auch mit der agrarpolitischen Dimension auseinandersetzte, und das nicht unkritisch, dass er dagegen eine agrarromantische Verklärung der guten alten Zeit ablehnend gegenüberstand. Damit dürften auch Zenders Arbeiten etwas präziser herausgearbeitet sein.
3.9 Weitere Publikationen Zenders in den Organen des Eifelvereins
Am 14. und 15.10.1961 fand eine Hauptversammlung des Eifelvereins in Wildenburg/Hellenthal statt. Als thematischen Schwerpunkt wählte man die Eifeler Mundart, worüber Matthias Zender referierte. Schulrat Odenbach diskutierte verschiedene Möglichkeiten, die Mundart im Schulunterricht zu fördern (193). 1962 veröffentlichte Zender seinen Vortrag über „Die Stellung der Mundarten und ihre Bedeutung in der Gegenwart“ in der „Eifel“ (194). Er skizzierte die Entwicklung und die räumliche Struktur der Eifeler Mundart, die er als „Fundament unseres Eifeler Volkstums“ bezeichnete. Das Verhältnis zur Hoch- beziehungsweise Schriftsprache wurde ebenso angesprochen wie die Veränderungen in den letzten Jahren. Vor der Verdrängung der Mundarten in den Schulen wird gewarnt und bedauert, dass es keine anspruchsvollen literarischen Texte im Eifeler Platt gebe.
1963 gab der Vorsitzende des Eifelvereins, Josef Schramm, einen großformartigen Sammelband mit einem Umfang von 320 Seiten heraus: „Die Eifel. Land der Maare und Vulkane.“ Neben der gelungenen graphischen Gestaltung mit zahlreichen ganzseitigen, auf Hochglanzpapier gedruckten Schwarz-Weiß-Fotos ist die inhaltliche Konzeption hervorzuheben: Es gelang dem Herausgeber, eine ganze Reihe renommierter Autoren zu gewinnen, die auf jeweils circa zehn Druckseiten ihr Fachgebiet so überzeugend zu präsentieren verstanden, dass eine zusammenhängende Landeskunde der Eifel entstand, die man fast schon mit der legendären Vereinsfestschrift von 1913 vergleichen kann. Zenders Beitrag zur Volkskunde zeigt eindrucksvolle Bilder der Eierlage in Schönecken und der Säubrennerkirmes in Wittlich, des Straßenkarnevals in Eupen und der Echternacher Springprozession. Unter dem Obertitel Wirtschaft und Verkehr finden sich Beiträge zur Industrie, zu Landwirtschaft, Talsperren, Verkehr, Nürburgring, Tourismus, Kurorten und Heilquellen sowie zum Wandern und zum Wintersport. 6.000 Exemplare dieser Publikation, von der 1964 eine zweite Auflage erschien, wurden innerhalb weniger Wochen verkauft (195).

Karte der Zwergsagen. (Zender, Erzählgut 1938)
1971 veröffentlichte Zender einen Artikel über „Eifeldörfer im Wandel“ (196). Er stellt eine glänzende Analyse der Entwicklung der Nachkriegszeit dar: Zunächst bemerkte er, dass zwar der Anteil der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung erheblich zurückgegangen sei, konstatierte dann aber einen „Traditionsüberhang“, eine „bäuerliche Grundhaltung“, die sich auch bei Familien zeige, die längst in der Stadt arbeiteten. Dann unterstreicht er die verkehrsferne Lage der Eifel, was sich allerdings damals schon erheblich relativiert hatte, und die durch neue Grenzen bedingte Lage der Westeifel in einem „toten Winkel“, was sich freilich durch die gerade von den Vorsitzenden des Eifelvereins (Josef Schramm, Konrad Schubach) lautstark vorgetragenen Forderungen nach einer grenzüberschreitenden Strukturpolitik auch ändern sollte. Nach dem Krieg habe das traditionelle Brauchtum erheblich an Bedeutung verloren, habe sich auf die Kirmes konzentriert und in die Familie verlagert. Neue und kommerzielle Formen des Festes entstanden. Beispiele sind der Bitburger Bedamarkt, der Mayener Lukasmarkt, die Wittlicher Säubrennerkirmes und die Dürener Annakirmes. Dagegen wehrt er sich: „Die hiesigen Bräuche eignen sich in ihrer schlichten und einfachen Art nicht zu Spiel und Schaustellung.“
Auch die Mentalität der Menschen hatte sich verändert: Der „konservative Bauer“, der mit seinem Starrsinn den Landwirtschaftslehrer in die Verzweiflung trieb, sei verschwunden. Jetzt werde nur noch über „neue Maschinen, neue Hofanlagen, neue Arbeitsweisen“ diskutiert.“ Man sei „dem Fortschritt aufgeschlossen.“ Doch das habe Folgen: Bauern wollen um jeden Preis unrentable Höfe vergrößern. Bauerntöchter wollen keinen Landwirt, sondern einen „Gehaltsmann“ heiraten. Viele schaffen den „Absprung in die Industriearbeit“ nicht und kehren zurück in das „kleinbäuerliche Proletariat“. Zender erkennt eine gewaltige „Umstrukturierung“, die die bäuerliche Welt nachhaltig verändert und in eine „industriebestimmte Welt“ verwandelt. Dieser Weg sei für viele Menschen „sehr lang und schwer. … Dennoch muß er gegangen werden.“ Mit dieser deutlichen Analyse stand Zender unter den Autoren des Eifelkalenders – wie gleich noch zu zeigen sein wird – ziemlich allein da. Die Redaktion milderte den Text auch etwas ab, indem sie eine einseitige Abbildung platzierte, auf der eine Bäuerin mit der Heugabel einen von zwei Kühen gezogenen Wagen belädt.
„Eifel zwischen Tradition und Neuerung“ war das Thema einer weiteren Standortbestimmung im Jahre 1978 (197). Zender begann mit einem Hinweis auf die Unterstützung seiner Forschungen durch den Eifelverein und unterstrich, auch der Verein habe von Anfang an erkannt, die Eifel „habe alte und bodenständige Lebensformen besonders gut bewahrt und diese seien der Pflege und Erhaltung wert.“ Dann holt er weit aus und kommt von der Territorialgeschichte über die Dorf/Dorp- und die Haus-/Husgrenze zum Anerbenrecht und zur Realteilung. Dann hebt er das betont bäuerliche Bewusstsein mit seinem Stolz auf den eigenen Hof und auch das spezifische Brauchtum hervor. Davon ausgehend skizziert er die Veränderungen im 19. Jahrhundert und kommt dann auf den „beschleunigten Wandel“ der letzten Jahrzehnte zu sprechen. Das Brauchtum und die Familienstrukturen hätten sich verändert, aber die Mundart sei geblieben. Zender verweist auf die Bedeutung der Förderung junger Familien. „Wir haben in dieser Lage kein Patentrezept,“ aber es wäre schon eine Hilfe, wenn die Verwaltung die Situation analysiere und Hilfe versuche. „So sehr wir auch das geschichtlich gewordene Bild als vertraut empfinden und die geschaffene Grundlage wahren wollen, zu Rat und Hilfe für diese suchenden Menschen sind wir aufgerufen.“ Ähnlich wie bei seinem Kriegsvortrag von 1942 zeigt sich hier, dass Zender ein detaillierter Kenner der Geschichte und ein glänzender Beobachter der Gegenwart ist, dass er Veränderungen beschreiben und analysieren kann, dass er aber keine Ratschläge erteilt und keine Forderungen stellt.
Zenders letzter Aufsatz „Bei den Erzählern von Sagen und Märchen in der Eifel“ stammt von 1980 (198). Auf Wunsch der Schriftleitung verfasste er einen Rückblick auf seine Sammeltätigkeit, in der ihn 50 Jahre zuvor ein Artikel im Eifelvereinsblatt unterstützt hatte. Der Artikel – der gleichzeitig für die für 1981 vorbereitete Neuausgabe der „Volksmärchen“ wirbt – ist mit einer einseitigen Abbildung ausgestattet, die Bauern beim Beladen eines Heuwagens zeigt.
Die Verbundenheit mit dem Eifelverein kommt auch in mehreren Artikeln zu seinen Geburtstagen zum Ausdruck. 1967 gratulierte ihm die Redaktion in der Vereinszeitschrift „Die Eifel“ zum 60., (199) 1972 der Hauptvorsitzende Josef Schramm zum 65. (200) und 1977 der Hauptgeschäftsführer Friedrich Wilhelm Knopp zum 70. Geburtstag (201). Ebenfalls 1977 veröffentlichte der Volkskundler und Zender-Schüler Wolfgang Kleinschmidt eine Würdigung im Eifeljahrbuch für 1978 (202). Auch zum 75. und zum 80. Wiegenfest erschienen Glückwünsche (203). Merkwürdigerweise findet sich in der Vereinszeitschrift kein Nekrolog, doch hatte Zender auch keine Funktion innerhalb des Vereins bekleidet.
4. Dr. Heinz Renn
Eine weitere interessante Person an der Schnittstelle zwischen dem Bonner Institut und dem Eifelverein ist Dr. Heinz Renn (gestorben 1992) (204). Der in Hamburg geborene Renn wuchs nach dem frühen Tod seines Vaters bei den Großeltern in Baasem (heute Gemeinde Dahlem) auf, legte in Münstereifel das Abitur ab und studierte ab 1933 in Bonn Philologie und Geschichte. 1939 promovierte er bei Franz Steinbach und Camille Wampach (205) über „Das erste Luxemburger Grafenhaus (963-1136).“ Die Arbeit erschien 1941 als Band 39 im Rheinischen Archiv (206). Gleichzeitig leitete er eine studentische Arbeitsgruppe, die ein Manuskript über „Französische Kulturpolitik und französische Kulturpropaganda in den westdeutschen Grenzlanden“ erarbeitete. Die Arbeit wurde im „Reichsberufswettkampf“, einem von der Deutschen Arbeitsfront, der Hitlerjugend und dem NSD-Studentenbund seit 1934 durchgeführten Leistungswettbewerb, als „reichsbeste Arbeit“ ausgezeichnet.
Renn bot man eine Assistentenstelle am Institut an, doch soll er abgelehnt haben, weil ihm ein Vertreter des „Reichstudentenführers“ mitteilte, dass er „als praktizierender Katholik keine Chance hätte, jemals eine Professur zu erhalten.“ (207) Außerdem sollen ihn der politische Fanatismus und die Vorgänge um die Entfernung seines Lehrers Camille Wampach zutiefst schockiert haben (208). Renn legte stattdessen ein Staatsexamen ab und wurde Referendar in Bad Godesberg (heute Stadt Bonn). Danach war er dann fünf Jahre lang Soldat, davon drei Jahre an der Ostfront, wo er verwundet wurde. Nach dem Krieg eröffnete er in Schmidtheim (heute Gemeinde Dahlem) eine Privatschule, wurde dann Studienrat in Köln und Euskirchen, 1955 stellvertretender Direktor in Münstereifel und schließlich 1963 Direktor des Gymnasiums in Jülich.
Seine Personalakte enthält etwas andere Informationen, die die auf Renns Angaben beruhenden Äußerungen freilich nicht ausschließen müssen. Danach wurde Renn 1938 als Assistent eingestellt. Aus seinem Lebenslauf geht hervor, dass er sich als „politischer Student … stets einsatzbereit gezeigt“ habe: Seit April 1933 gehörte er der SA an, seit 1934 dem NSD-Studentenbund, und 1937 wurde er in die NSDAP aufgenommen. An allen drei „Reichsberufskämpfen der Studentenschaft“ habe er „aktiv teilgenommen“, 1937/1938 als Mannschaftsführer, wobei die von ihm geführte Gruppe „eine Reichsbeste Arbeit schrieb.“ Zudem war er als „Bücherwart“ des Instituts tätig. Weiter geht aus den Unterlagen hervor, da sich Renn parallel dazu auf sein Staatsexamen im Februar 1939 vorbereitete. Am 1.7.1938 wurde er am Institut eingestellt und am 28.1.1940 zur Wehrmacht eingezogen. Sein bis 1941 befristeter Vertrag wurde bis 1944 immer wieder verlängert (209).
Renn war neben seiner Tätigkeit im Schuldienst in mehreren historischen Vereinen tätig und ist dabei durch eine Vielzahl von Vorträgen, Exkursionen und Studienfahrten hervorgetreten. Zudem veröffentlichte er 65 landeskundliche Beiträge, darunter 1941, 1954 und 1956 drei Aufsätze in den Vierteljahrsblättern (210). 1955, 1956, 1957 und 1958 erhielt er Werkverträge von der Arbeitsgemeinschaft für westdeutsche Landes- und Volksforschung, die von Steinbach und Droege unterzeichnet sind. Renns Honorar in Höhe von jeweils 1.000 DM war für recht vage bezeichnete Forschungen vorgesehen. Zunächst ist von einer „Geschichte der Eifel“ die Rede, dann von einer „Geschichte des Eifel-Ardennenraumes“ und schließlich von „Forschungen zur Geschichte der territorialen und kulturellen Entwicklung der Eifel.“ Renns Eifelbuch war also 40 Jahre vor seinem Erscheinen 1994 durch das Bonner Institut beziehungsweise den Verein maßgeblich gefördert worden (211).
Danach scheint sein Verhältnis zu dem Bonner Institut abgekühlt zu sein. Angeblich soll ihm Steinbach eine Stelle am Institut angeboten haben, die Renn abgelehnt haben soll. Auf eine Entfremdung deutet die Festschrift zu seinem 75. Geburtstag hin. Der Band „Geschichte der Eifel. Gesammelte Aufsätze“ erschien 1986 in erster und 1987 in dritter Auflage. Die Herausgeber des seiner Frau gewidmeten Buches waren seine vier Kinder (212). Das Titelblatt weist außerdem auf Geleitworte „der Professoren an der Universität zu Köln: Dr. Bers, Dr. Corsten, Dr. Kloock“ hin. Günter Bers (geboren 1940) unterschieb aber als stellvertretender Vorsitzender des Jülicher Geschichtsvereins, Severin Corsten (1920-2008) für den Historischen Verein für den Niederrhein und Josef Kloock (geboren 1935) für den Verein Alter Münstereifeler, womit nochmals die Koordinaten von Renns Aktivitäten abgesteckt sind.
Renn gründete in Schmidtheim eine Ortsgruppe des Eifelvereins, leitete dann die in Bad Münstereifel und war seit 1964 Vorsitzender der Bezirksgruppe Düren-Jülich. Seit 1973 war er Hauptheimat- und -kulturwart des Eifelvereins, war in dieser Funktion Mitglied im Hauptvorstand und somit für die gesamte Kulturarbeit des Vereins zuständig (213). Neben seinem Engagement für die Beibehaltung des Heimatkundeunterrichts in den Schulen, ein Thema, für das sich auch der Eifelverein nachdrücklich einsetzte, verfasste er mehrere Beiträge für dessen Periodika.
1978 wurde Renn pensioniert. Gesundheitlich schwer angeschlagen, bemühte er sich unermüdlich, seine Forschungen zu Papier zu bringen. Als dann die Feiern zum 100-jährigen Gründungsjubiläum des Eifelvereins im Jahre 1988 anstanden, übernahm es Renn, für die Festschrift eine 125 Druckseiten umfassende „Geschichte der Eifel bis 1888“ zu verfassen. Auch wenn man dem Verfasser vorwerfen kann, dass er sich nicht bei jedem Thema auf dem letzten Stand der Forschung bewegte, so kann man ihm doch bescheinigen, dass er nach der kleineren Darstellung von Kaufmann oder Schramms Eifelwerk (214) die erste zusammenfassende Geschichte der Region vorgelegt hat, die zudem aus einem Guss ist und ein breites Publikum erreichte: Von Schramms Eifelwerk wurden 6.000, von der Festschrift 12.000 Exemplare verkauft. Man wird Renns Werk also nicht gerecht, wenn man ihn nur als Forscher, nicht aber als Multiplikator im weitesten Sinne ansieht.

'Dieses friedliche Gespann – früher zur Erntezeit in der Eifel ein vertrautes Bild – wurde längst von Traktoren und Erntemaschinen abgelöst'. (Eifelkalender 1971, S. 89, Eifelbibliothek Mayen)
Nachdem Renn 1990 eine Ortsgeschichte von Baasem herausgegeben hatte, entstand der Gedanke, seinen voluminösen Beitrag zur Eifelfestschrift zu einem Buch auszubauen. Hierzu entschied sich der Verfasser aus Kostengründen für einen unveränderten Nachdruck der Kapitel bis zum beginnenden 19. Jahrhundert und setzte das Werk dann bis in die 1990er Jahre fort. Renns Vorwort stammt aus seinem Todesjahr 1992. Das reich illustrierte Werk mit dem Titel „Die Eifel. Wanderung durch 2000 Jahre Geschichte, Wirtschaft und Kultur“ wurde 1994 vom Eifelverein herausgegeben und erschien bereits 1995 in einer zweiten Auflage. Für die dritte Auflage im Jahre 2000 schrieben seine Frau und die Kinder ein umfangreiches Kapitel über die 1990er Jahre neu, 2006 kam noch eine vierte Auflage auf den Markt. Es ist bemerkenswert, dass keine davon in den Rheinischen Vierteljahrsblättern rezensiert wurde und dass bei den zahlreichen Danksagungen in den Vorworten das Institut nicht genannt wird. Dies gilt auch für seine 1986 in erster Auflage erschienenen gesammelten Schriften (215).

Titelblätter der Zeitschrift 'Die Eifel', 45 (1950), Nr. 3. (Eifelbibliothek Mayen)
5. Eifelverein, der Heimatgedanke und der kulturelle Wandel der Nachkriegszeit
Zenders Veröffentlichungen in den Publikationen des Eifelvereins erreichten ein breites Publikum. Das Eifeljahrbuch hatte eine Auflage von 6.000 bis 8.000 Exemplaren, „Die Eifel“ ging an sämtliche Mitglieder. 1954 hatte der Eifelverein 13.000 Mitglieder, 1973 waren es 31.500 und 1980 54.000. Es war jedoch nicht nur das Wanderangebot, das den Verein so attraktiv machte und auch nicht das damit verbundene Programm an kulturellen und geselligen Veranstaltungen, es war die Rolle des Vereins als Heimatorganisation in einem strukturschwachen Raum. Dieses Angebot war so attraktiv, dass der Verein auch in den angrenzenden Großstädten großen Zulauf zu verzeichnen hatte, in denen ein umfangreiches Kulturprogramm mit Vorträgen und Konzerten geboten wurde.
Hinsichtlich des Umgangs mit den von Zender angesprochenen Problemen verfocht der Eifelverein keine so ganz klare Linie. Auf der einen Seite setzte er sich unter seinem Vorsitzenden Josef Schramm (1938-1945, 1954-1973) massiv für die strukturschwache Region ein, deren Probleme (Schulen, Arbeitsplätze, Verkehrsverbindungen) nur im europäischen Kontext gelöst werden konnten (216). Sein Nachfolger Konrad Schubach (1973-1991), der noch weitaus besser in der Landespolitik vernetzt war, nutzte dies dazu, den Eifelverein zu einer schlagkräftigen Bewegung für den Landschafts- und Umweltschutz, die Denkmalpflege und die Landwirtschafts- beziehungsweise Strukturpolitik zu machen (217).

Titelblätter der Zeitschrift 'Die Eifel', 46 (1951), Nr. 8. (Eifelbibliothek Mayen)
Allerdings hatte der wirtschaftliche Aufschwung durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft, die verbesserte Mobilität und die Förderung des Tourismus auch ihreSchattenseiten: Die Lebens- und Arbeitswelt der Menschen veränderte sich. Ein erster Innovationsschub fand bereits im 19. Jahrhundert statt. 1864 wurde mit dem Bau der Eifelbahn von Köln nach Trier begonnen und 1888 der Eifelverein gegründet, der sich die Förderung des Tourismus auf seine Fahnen schrieb. 160.000 Auswanderer verließen im 19. Jahrhundert die Eifel und schrieben Briefe aus der „Neuen Welt.“ Im „Kulturkampf“ befehdeten sich in vielen Dörfern die Pfarrer und die Bürgermeister; zahlreiche Klöster wurden aufgehoben; die katholische Presse berichtete ausführlich darüber. Zeitungen gelangten auch in die Eifeldörfer.
In den 1930er Jahren nahm das Tempo der Veränderungen dann rasant zu: Zender erwähnt den Bau des Westwalls, zu ergänzen wären noch für die nördliche Eifel die Ordensburg Vogelsang, die Meisterschule der Malerei in Kronenburg, die Künstlerkolonie Heimbach und der Bau von Stauseen (Rurtalsperre Schwammenauel) (218). Diese Großprojekte beseitigten die drückende Arbeitslosigkeit, verbesserten für einige Jahre die wirtschaftlichen Verhältnisse und blieben den Zeitgenossen nachdrücklich in Erinnerung, da sie in der gleichgeschalteten Presse, darunter auch den Zeitschriften des Eifelvereins, gebührend gefeiert wurden.
Noch tiefgreifender waren die Veränderungen im Zweiten Weltkrieg (Ardennenoffensive) und in der Nachkriegszeit, vor allem die Industrialisierung der Landwirtschaft, die zunehmende Verkehrserschließung, die europäische Einigung, die Landflucht und die Pendlerströme. Die Dörfer und die Familien, die Lebens- und die Arbeitswelt der Landbevölkerung veränderten sich innerhalb weniger Jahrzehnte in einem Ausmaß, dass selbst Matthias Zender seine Eifel kaum noch wiederkennen würde.

Titelblätter der Zeitschrift 'Die Eifel', 48 (1953), Nr. 3. (Eifelbibliothek Mayen)
In den 1950er und 60er Jahren war der Eifelverein deshalb so attraktiv, weil er den Menschen in einer Phase beschleunigten Wachstums eine Orientierung vermitteln konnte. Freilich barg dies die Gefahr, dass der Verein zum Sammelbecken rückwärtsgewandter Traditionalisten werden konnte, die in Heimatabenden, Trachtenfesten und Eifeltagen ihre Parallelwelt inszenierten, einen Heile-Welt-Erlebnispark für ältere Menschen, während ihre Enkel die Wochenenden lieber im Kino verbrachten, wo sie Filme aus einer anderen Traumfabrik sahen. Gerade in einer individualisierten Gesellschaft, die sich mit zunehmender Technik und Globalisierung rapide veränderte und damit die Menschen oftmals überforderte, ergab sich ein Bedürfnis nach Orientierung an der Heimat und Tradition, die für die gute alte Zeit, die eigene Kindheit stand; ein Bedürfnis nach funktionierenden Gemeinschaften, das auch in der Mitgliederwerbung immer wieder eine zentrale Rolle spielt (219).
Die Zeitschriften des Eifelvereins betreute von 1932 bis 1966 Dr. Viktor Baur und ab 1966 bis 1985 Friedrich Wilhelm Knopp (gestorben 1986). Ab 1960 erschien „Die Eifel“ in einem handlichen Format, ab 1967 in einer sehr ansprechenden graphischen Gestaltung. Auch inhaltlich gab es Veränderungen. „Die Eifel“ war nicht nur ein Mitteilungsblatt für die Vereinsmitglieder und mit ihrer Rubrik „Eifeler Nachrichten“ ein Informationsforum für die Region, sondern vor allem in den 1950er und 60er Jahren auch ein Heimatmagazin, das die Schönheiten der Region verherrlichte. Dazu trug die Bildausstattung wesentlich bei, vorzügliche Schwarzweißtafeln von idyllischen Eifeldörfern, pittoresken Kleinstädten, romantischen Sommer- und Winterlandschaften, fröhlichen Wandergruppen und verklärte Szenen aus der vorindustriellen Arbeitswelt, wie sie auch Zenders Artikel schmückten. Dass die Redakteure dabei über Jahre und Jahrzehnte auf das gleiche Bildmaterial zurückgriffen und es zum Teil mehrfach verwendeten, störte niemanden.
Eine gewisse Bipolarität lässt sich auch bei den Artikeln beobachten. Wir finden insbesondere im Jahrbuch eine ganze Reihe von Beiträgen, die sich ausführlich mit Gegenwartsfragen befassen und nicht ohne Begeisterung vom Autobahnbau, von Radioteleskopen und vom Braunkohletagebau berichten. Es gibt aber auch zahllose Artikel, die recht unkritisch die „gute alte Zeit“ verklären beziehungsweise Geschichten und Gedichte, die sie zum Inhalt haben. Geradezu als Chefideologen der Heimatbewegung kann man den Dürener Lehrer Dr. Fritz Milz (gestorben 1993) ansehen, der zahlreiche Beiträge über den Untergang der alten Dörfer, Schulen, Gasthäuser und Bauernhäuser in der Eifel verfasste (220). Ab den 1970er Jahren traten solche und auch heimatkundliche Aufsätze etwas in den Hintergrund, größeres Interesse bestand an Artikeln, die Glanzlichter unter den Ausflugszielen ins rechte Licht rückten.

Titelblätter der Zeitschrift 'Die Eifel', 50 (1955), Nr. 11-12. (Eifelbibliothek Mayen)
Wir können also beim Eifelverein zwei gegensätzliche Tendenzen erkennen, einmal die massiv vorgetragene Forderung nach einer Strukturpolitik für die Region, die den Menschen Arbeit, Bildung und Lebensqualität versprach. Auf der anderen Seite erkannten die Menschen, dass der Fortschritt – der ja in der Westeifel wesentlich bescheidener ausfiel als in den Einzugsbereichen der Großstädte im Norden und Osten – auch seinen Preis hatte. Steigende Mobilität, Pendlerströme, Tourismus und wachsender Wohlstand veränderten das Leben in den Dörfern. Dies wurde nicht nur als Fortschritt begrüßt, sondern auch als Verlust von Traditionen und Identitäten, als Untergang einer liebgewonnenen und zunehmend verklärten Heimat gedeutet.
Hier erfüllten auch Zenders Bücher eine wichtige Funktion. Sie sind eine Dokumentation über eine untergegangene Welt. Eine Welt, an der aber auch heute noch großes Interesse besteht. Dies zeigen nicht nur die schönen Bildbände mit historischem Bildmaterial, die immer wieder auf den Markt gebracht werden, sondern auch die Kritiken, mit denen der Film von Edgar Reitz „Die andere Heimat“ bedacht wurde, in dem die Armut und die Auswanderung in einem Hunsrückdorf des 19. Jahrhunderts thematisiert wurden. Das Thema Heimat hat heute nicht mehr den hohen Stellenwert, den es in den 1950er und 60er Jahren besessen hat, aber es bleibt aktuell.
6. Der Eifelverein und die volkskundliche Forschung
Zenders Beiträge sind aber noch unter einem anderen Gesichtspunkt von Interesse: Es gab damals einen engen und fruchtbaren Kontakt nicht nur zwischen den Sprachwissenschaftlern und Volkskundlern des Bonner Instituts für geschichtliche Landeskunde, sondern auch zu den Heimatforschern der Eifel und dem Eifelverein. Bereits 1913 verfasste der Kölner Sprachwissenschaftler und Volkskundler Adam Wrede (1875-1960) für die Festschrift zum 25. Gründungsjubiläum des Eifelvereins einen grundlegenden Artikel zum Thema Bauernleben in Sitte und Brauch (221). Für das bereits genannte Eifelwerk von Josef Schramm steuerte Matthias Zender 1963 einen kurzen, aber prägnanten Aufsatz zur Volkskunde bei (222). Für die Festschrift zur 100-Jahrfeier des Eifelvereins konnte Zender wohl aus Altersgründen diesen Beitrag nicht mehr übernehmen; Matthias Weber (1928-2006), im Hauptberuf Professor für Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Köln und Heimatforscher, lieferte einen umfangreichen, mit Zeichnungen illustrierten Aufsatz (223). Für die Festschrift von 2013 konnten mit Alois Döring und Dagmar Hänel zwei Autoren gewonnen werden, die das Thema Volkskunde nicht nur in seiner historischen Dimension, sondern auch die Veränderungen der letzten Jahre behandelten (224).
Dörings Beitrag endete mit einem Plädoyer für eine Entmythologisierung der volkskundlichen Forschung. Er beklagte „eine unkritische Übernahme der romantisch-nationalen Germanenmythologie des 19. Jahrhunderts (von den Nationalsozialisten aufgegriffen und ideologisch instrumentalisiert), Brauchüberlieferungen in ungebrochener Kontinuität bis in graue germanische Vorzeit zurückführen zu wollen.“ Dann zitiert er die Magisterarbeit von Petra Scraback über die volkskundlichen Beiträge in der Zeitschrift „Die Eifel“, die zu folgendem Ergebnis kommt: „Als unmittelbare, wissenschaftlich verwertbare Quelle sind die volkskundlichen Artikel der Zeitschrift des Eifelvereins nicht geeignet. Die Mehrzahl der Autoren dokumentiert die Bräuche nur sehr lückenhaft und interpretiert deren Herkunft und Funktion mit, dem heutigen Stand der wissenschaftlichen volkskundlichen Forschung nicht mehr entsprechenden Theorien.“ (225)
Leider kann man den beiden Autoren nicht allzu sehr widersprechen. Volkskundliche, aber auch Beiträge zur Landesgeschichte und zur Mundartenforschung für die zahlreichen Kalender und Jahrbücher der Vereine und Landkreise werden heute zum großen Teil von Laien verfasst, die zudem „ihren“ Brauch und „ihre“ Mundart dokumentieren, um nicht zu sagen rechtfertigen wollen. Stärker noch als die Landesgeschichte hat sich die Volkskunde in den letzten Jahrzehnten zu einer „empirisch arbeitenden Sozial- und Kulturwissenschaft“ entwickelt, deren theoretische Konzepte, Methoden und Fragestellungen bei den Amateurforschern vor Ort (noch) nicht angekommen sind (226). Man muss aber auch festhalten, dass zu einem Dialog zwei Seiten gehören (227). Und hier lässt sich beobachten, dass es einen Rückzug der Fachwissenschaftler in die akademischen Elfenbeintürme gegeben hat. Im modernen Wissenschaftsbetrieb und im Kampf um Rankingpositionen und Drittmittel haben theorielastige und fußnotenreiche Beiträge in einer nur noch wenigen Experten verständlichen Fachsprache offensichtlich einen höheren Stellenwert als allgemeinverständliche Beiträge für einen breiten Leserkreis (228). Dies gilt nicht nur für die Volkskunde, sondern auch für die anderen, mehr oder minder eng mit dem Bonner Institut verbundenen Fächer (229). Und nicht zuletzt gilt dies auch den Bereich der Archive, deren Benutzerkreis und deren Arbeitsweise sich nachhaltig verändert haben (230).
Dies zeigt sich auch, wenn man die inzwischen auch digital zugänglichen Inhaltsverzeichnisse der beiden Periodika des Eifelvereins durchsieht (231). Hier findet man eine ganze Reihe von Beiträgen aus der Feder der älteren Volkskundlergenerationen wie Adam Wrede oder Matthias Zender, doch dann ist ein Bruch festzustellen; von den zahlreichen Schülern und wissenschaftlichen Enkeln von ihnen, die am Bonner Institut, am LVR-Institut oder am LVR-Freilichtmuseum Kommern tätig waren, findet sich kaum einer, der an einer Publikation seiner Forschungsergebnisse für einen größeren Leserkreis Interesse hatte (232). Dies gilt auch für die Bereiche Landesgeschichte und Sprachgeschichte beziehungsweise Mundartenforschung.
7. Epilog: Ein Mensch in seiner Zeit
Dieser Beitrag versuchte, von der Person Matthias Zenders ausgehend ein Kapitel der rheinischen Wissenschaftsgeschichte der 1930er Jahre auszuleuchten. Es ging vor allem um das Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande an der Universität Bonn und um den Eifelverein, aber auch andere Beteiligte. Exponenten waren neben Matthias Zender, Franz Steinbach und Karl Leopold Kaufmann eine Reihe weiterer Personen. Es konnte aufgezeigt werden, wie hier eine wissenschaftlich außerordentlich fruchtbare und ertragreiche Konstellation entstand, die dann freilich über die „Westforschung“ mehr oder minder freiwillig in den Sog des „Dritten Reichs“ geriet. Dessen ambitionierte Kulturpolitik ermöglichte eine ganze Reihe von Karrieren, Projekten und Publikationen, wobei es höchst aufschlussreich ist, in welchem Maße sich die Betroffenen darauf einließen.
Nicht systematisch, aber anhand mehrerer Beispiele ließen sich auch die Traditionen und Kontinuitäten in der Nachkriegszeit darstellen. Die gleichen Akteure arbeiteten in den gleichen Positionen zum Teil sogar über die gleichen Themen weiter. Weder haben sich die Landeshistoriker kritisch mit der eigenen „Westforschung“ befasst noch der Eifelverein. Dieser hatte sich, bedingt durch die Vita und die wissenschaftlichen Interessen Karl Leopold Kaufmanns, in der Eupen-Malmedy-Frage sehr engagiert. Ab 1933 stellte er sich und seine Organe rückhaltlos in den Dienst der braunen Propaganda, da er glaubte, die neuen Machthaber würden den wirtschaftlichen Aufschwung der Eifel und den Heimatgedanken fördern. Der Eifelverein war bereits in der Weimarer Republik eine Keimzelle der Heimatbewegung, auf der Suche nach einer Orientierung begeisterten sich viele Mitglieder für die Schönheit der Eifel und ihre bäuerliche Tradition, die mit Bildern und Texten in der Mitgliederzeitschrift als heile Welt inszeniert wurden. Dass auch die Heimatbewegung im „Dritten Reich“ instrumentalisiert wurde, haben viele Mitglieder zunächst nicht bemerkt. In den 1950er und 60er Jahren erwies sich der Heimatgedanke dann nach dem Trauma von Bombenkrieg und Vertreibung nochmals als Erfolgsgeschichte, durch ständig wachsende Mitgliederzahlen entstand „die größte Bürgerinitiative der Eifel“, die sich auch für den Natur- und Landschaftsschutz engagierte.
Ab den 1970er Jahren gerieten dann das Institut wie auch der Verein in eine Krise, nicht nur die Forschungslandschaft veränderte sich gravierend, auch die Wanderszene war einem Wandel unterworfen, kommerzielle und professionelle Anbieter drängten auf den Markt, die Organisationsform des ehrenamtlich arbeitenden Vereins verlor an Attraktivität, und sinkende Mitgliederzahlen machten es zunehmend schwieriger, die selbst gesteckten Aufgaben zu erfüllen.
Wir haben jedoch nicht nur eine Geschichte der Institutionen, sondern auch die Rolle einzelner Persönlichkeiten kennengelernt, wobei insbesondere die Karriere und das wissenschaftliche Werk eines aus der Eifel stammenden, intensiv im katholischen Milieu verwurzelten und an einem renommierten Gymnasium vom Humanismus geprägten Wissenschaftlers präziser und detaillierter herausgetreten ist als bisher bekannt. Seine entscheidenden Karriereschritte fielen in die schwierige Zeit des „Dritten Reichs“, und es ist spannend zu sehen, wie Zender meistens, aber nicht immer erfolgreich auf seinem selbst gewählten Pfad, sich selbst treu zu bleiben, es sich aber auch mit den Machthabern möglichst nicht zu verscherzen, bewegte und wie er dabei von seinen Lehrern und Kollegen unterstützt wurde. Auch im Krieg blieb er dieser Linie treu, trotzdem musste er durch widrige Umstände länger als andere, die sich wesentlich mehr verstrickt hatten, im (Untersuchungs-)Gefängnis sitzen. Seinen Weg konnte er auch nach dem Krieg fortsetzen, bis er dann weniger durch Seilschaften, Protektion und Anbiederung als durch seine wissenschaftliche Leistungen auf den Bonner Lehrstuhl berufen wurde. Mit Zenders Emeritierung 1974 war jedoch trotz seiner ungebrochenen Schaffenskraft im Alter seine Zeit vorbei und es war höchste Zeit, neue Themen und zugkräftige neue Projekte zu entwickeln.
Bereits im Mittelalter beschäftigten sich Klöster in Zeiten der Krise und des Umbruchs mit der eigenen Geschichte. Man kann dann die Gegenwart besser verstehen, aber kann man auch für die Zukunft lernen? Das Erfolgsrezept der 1930er Jahre beruhte nicht nur auf der erfolgreichen Kooperation der heute noch existierenden Institute und Vereine, sondern war vorrangig auch eine Frage der Persönlichkeiten: Köpfe wie Zender, Steinbach, Petri und Ennen, aber auch Kaufmann, Schramm und Schubach haben sich über Jahrzehnte hinweg unermüdlich für ihre Sache eingesetzt. Zum Zweiten waren sie Männer beziehungsweise Frauen mit innovatorischen Ideen, die sie ihren Mitgliedern und Mitarbeitern auch vermitteln konnten. Und zum Dritten besaßen sie in der Regel ein weitgespanntes wissenschaftliches Netzwerk, Beziehungen zur Politik und zu den entsprechenden Geldgebern, ohne die sich auch gute Projekte nun einmal nicht realisieren lassen. Kluge Köpfe mit guten Ideen, mit denen man die Mitglieder, die Kollegen, die Fachwelt, aber auch die Politik und die Geldgeber überzeugt und eine breite wissenschaftliche, publizistische und nicht zuletzt auch virtuelle Vermarktung der erbrachten Leistungen – das sind vielleicht Auswege aus der Krise.

Titelblätter der Zeitschrift 'Die Eifel', 52 (1957), Nr. 5. (Eifelbibliothek Mayen)
- 1: Das Forschungsvorhaben für diesen Beitrag wurde unterstützt durch die van-Meeteren-Stiftung Düsseldorf, die Kulturstiftung der Kreissparkasse Bitburg-Prüm und die Stiftung der Kreissparkasse Vulkaneifel.
- 2: Als 1987 in Trier der Sonderforschungsbereich 235 „Zwischen Maas und Rhein: Beziehungen, Begegnungen und Konflikte in einem europäischen Kernraum von der Spätantike bis zum 19. Jahrhundert“ eröffnet wurde, staunten die zum Teil aus Bonn stammenden Historiker nicht schlecht, dass Kritiker sie in einen Zusammenhang mit der „Westforschung“ stellten. In Trier besaß nicht nur die Kulturraumforschung einen hohen Stellenwert, sondern auch die Zentralitätstheorie Walter Christallers, die freilich auch dem „Dritten Reich“ ihre Entstehung verdankt. Leider ist die Internetseite „offline.“ Die kommentierte Bibliographie befindet sich unter: [Online]. Weitere Materialien und ein weitgehend unbenutzbares Kartenarchiv unter: [Online] – Glücklicherweise gibt es immer noch Resultate in Form von Printmedien: Irsigler, Franz (Hg.), Zwischen Maas und Rhein. Beziehungen, Begegnungen und Konflikte in einem europäischen Kernraum von der Spätantike bis zum 19. Jahrhundert. Versuch einer Bilanz, Trier 2006.
- 3: Gerlich, Alois: Renzension zu: Groten, Manfred/Rutz, Andreas (Hg.), Rheinische Landesgeschichte an der Universität Bonn. Traditionen - Entwicklungen - Perspektiven, Göttingen 2007. [Online]
- 4: Wenig, Verzeichnis, S. 346-347. Nachruf von Cox, Heinrich L., Matthias Zender 1907-1993, in: RhVjbl 58 (1994), S. XVII-XXV. Weitgehend identisch: Cox, Heinrich L., Nachruf Matthias Zender, in: RWZ 39 (1994), S. 11-19; Kerkhoff-Hader, Bärbel, Der Dank der Schülerin. Zum Tode von Matthias Zender, in: RWZ 39 (1994), S. 21-25; Herborn/Kerkhoff-Hader, Erinnerungen; Wiegelmann, Nachruf; Mangold, Schriftenverzeichnis; Fischer, Zender. Einen guten Überblick bietet der Artikel von Alois Döring im Internetportal Rheinische Geschichte. [Online]
- 5: Schwall, Gymnasium, S. 340. Weitere Einzelheiten zu Zenders Schul- und Universitätsbesuch im Lebenslauf seiner Dissertation.
- 6: Leider fehlt eine Biographie von Nikolaus Kyll, vgl. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), Band 4 (1992), Sp. 864-865; Monz, Lexikon, S. 243; Zender, Matthias, Nikolaus Kyll 1904-1973, in: RWZ 20 (1973), S. 254-257.
- 7: Steinhausen war zeitweise zur Erarbeitung der archäologischen Karte für den Regierungsbezirk Trier ans Rheinische Landesmuseum Trier abgeordnet und veröffentlichte 1936 eine „Archäologische Siedlungskunde des Trierer Landes“, Monz, Lexikon, S. 449-450.
- 8: Zwei Postkarten von Müller an Zender von 1919 und von 1924 sind veröffentlicht bei Mangold, Schriftenverzeichnis, S. 46-47. Zum Wörterbuch vgl. Zender, Matthias, Das rheinische Wörterbuch von 1904 bis 1964, in: RhVjbl 29 (1964), S. 200-222; Zender, Wörterbuch; Schrutka-Rechtenstamm, Volkskunde, S. 74-75.
- 9: Im Nachwort zum Rheinischen Wörterbuch gibt Zender an, daran von November 1929 bis April 1939 beschäftigt gewesen zu sein.
- 10: UAB, Promotions-Album C, S. 163-164. Aus der Dissertation erfährt man, dass die Gutachter Josef Müller und Hans Naumann waren, der Tag der mündlichen Prüfung der 22.6.1938, die Note: ausgezeichnet, das Datum der Promotion der 20.8.1940. Eine im Impressum der Arbeit angekündigte Publikation als Veröffentlichung des Instituts für geschichtliche Landeskunde ist wohl wegen des Krieges nicht zustande gekommen. Leider gelang es nicht, ein vollständiges Manuskript der Dissertation aufzutreiben. Die Universitäts- und Landesbibliothek Bonn besitzt keines, ein unvollständiger Stapel von Einzelseiten befindet sich in einem Karton mit Zenders Nachlass auf dem Speicher des Instituts, die Bibliothek verwahrt eine Kopie, bei der die gedruckten Passagen durch Fotokopien ersetzt sind (VE 292/1,1-2). Leider fehlt auch ein bibliographischer Nachweis für die zahlreichen Karten. Nach einem handschriftlichen Eintrag auf dem Vorsatz entspricht der Teildruck den S. 176-233 des Manuskripts, S. 167-176 erschienen als Aufsatz: Schinderhannes und andere Räubergestalten, in: RWZ 2 (1955), S. 84-94, vgl. auch Schirrmacher, Volkstumsbegriff, S. 554-555. Der ungedruckte erste Teil trägt die Überschrift „Erzähler und Volkserzählung“, der ebenfalls unpublizierte dritte „Erzähler und Gemeinschaft“, darunter Untersuchungen zur „soziologischen Struktur der Eifel“ und zum „Volksglauben im heutigen Volksleben.“
- 11: Zum Institut vgl. Groten/Rutz, Landesgeschichte. Zur Abteilung für Volkskunde vgl. Cox, Abteilung, S. 95-112; Schrutka-Rechtenstamm, Volkskunde; Höpfner, Universität Bonn, S. 289-392 (zu Steinbach und zur Landeskunde) und S. 448-456 (zur Volkskunde); Höpfner, Bonn; Schirrmacher, Volkstumsbegriff, insbes. Band 1, S. 177-259.
- 12: Zender, Matthias, Gedenkworte für Theodor Frings, in: RhVjbl 34 (1970), S. 1-8.
- 13: Nikolay-Panter, Marlene, Geschichte, Methode, Politik. Das Institut und die geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, in: RhVjbl 60 (1996), S. 233-262; Nikolay-Panter, Geschichte und Ansatz; Rusinek, Traditionen; Tiedau, Ulrich, Franz Steinbach, in: Haar/Fahlbusch, Handbuch, S. 661-666; Thomas, Bernard, Le Luxembourg dans la ligne de mire de la Westforschung. 1931-1940. La „Westforschung“ et l'„identité nationale“ luxembourgeoise, Luxembourg 2011. Sehr pointiert: Thomas, Luxemburg.
- 14: Ein unveränderter Nachdruck mit einem Vorwort von Franz Petri und Nachworten von Hermann Aubin und Matthias Zender (S. 232-241) erschien 1966.
- 15: Neuausgabe: Niessen, Josef, Geschichtlicher Handatlas der deutschen Länder am Rhein. Mittel- und Niederrhein, Köln 1950. Niessen hatte 1924 bei Hermann Aubin mit einer Arbeit über „Landesherr und bürgerliche Selbstverwaltung in Bonn von 1244-1794“ promoviert und war dann in den Schuldienst gegangen. Er wurde jedoch bis 1937 beurlaubt, um als Assistent am Institut Karten für die Kölner Jahrtausendausstellung 1925, die „Kulturströmungen“ sowie den Saaratlas anzufertigen. Für die Neuauflage des Handatlasses 1950 wurde der inzwischen in Bonn lehrende und forschende Niessen nochmals beurlaubt, vgl. Steinbach, Franz, Josef Niessen, in: RhVjbl 28 (1963), ohne Seitenangabe. Zu seiner Arbeit am Saaratlas, an dem auch Zender beteiligt war, vgl. Haar/Fahlbusch, Handbuch, S. 601-605, 607, 609, 663, 744, zu Zender S. 603, 748; Gansohr-Meinel, Landesstelle, S. 279-280; Mölich, Rheinlande, S. 121-122. Nur wenige Angaben bei Freund, Wolfgang, Volk, Reich und Westgrenze. Deutschtumswissenschaften und Politik in der Pfalz, im Saarland und im annektierten Lothringen 1925–1945, Saarbrücken 2006, S. 113-140, zu Zender S. 121, 290.
- 16: Hermel, Jochen, Verzeichnis der historischen Dissertationen am Bonner Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande 1920-2005, in: Groten/Rutz, Landesgeschichte, S. 267-282.
- 17: Zender, Matthias, Drei Karten zur Geschichte Luxemburgs, in: RhVjbl 1 (1931), S. 112-117; Nikolay-Panter, Vierteljahrsblätter.
- 18: Nikolay-Panter, Marlene, Der Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande. Gründung und frühe Jahre, in: RhVjbl 65 (2001), S. 374-399.
- 19: Mölich, Rheinlande, Zitat S. 116.
- 20: Mölich, Rheinlande, S. 116; Oberkrome, Volksgeschichte, S. 30-33, 68-73.
- 21: Leider konnte Reiners seinen Beitrag für den Sammelband von Aubin/Frings/Müller, Kulturströmungen, S. X, nicht abliefern. Hier sei nur der Hinweis gestattet, dass die Kunstgeschichte in den 1930er Jahren intensiv an dem fächerübergreifenden Dialog wie auch an der „Westforschung“ beteiligt war, vgl. zum Beispiel Zimmermann, Walter, Beiträge zur Kunstgeographie der Rheinlande, in: RhVjbl 1 (1931), S. 66-74; Zimmermann, Walter, Künstlerische Beziehungen in Eupen-Malmedy, in: RhVjbl 6 (1936), S. 280-294.
- 22: Mölich, Rheinlande, S. 113-116; Hermel, Jochen, Verzeichnis der Ferienkurse, Lehrgänge und Tagungen des Bonner Instituts für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande 1920-2005, in: Groten/Rutz, Landeskunde, S. 283-315. Zenders Vortrag wurde gedruckt: Gegenwartsvolkskunde, Heimatkunde, Heimatpflege, in: Pädagogische Rundschau 5 (1950-51), S. 529-537.
- 23: Schöttler, Westforschung; Schöttler, Landesgeschichte.
- 24: Fahlbusch, Michael, Wissenschaft im Dienst der nationalsozialistischen Politik? Die „Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften“ von 1931-1945, Baden-Baden 1999, S. 409-410; Fahlbusch, Deutschtumspolitik, S. 615-616 (mit ausführlicher, aber sehr pointierter Zusammenfassung); Werner, Wolfgang Franz, Der Provinzialverband der Rheinprovinz, seine Kulturarbeit und die ‚Westforschung‘, in: Dietz/Gabel/Tiedau, Griff, Band 2, S. 753-754.
- 25: Mölich, Rheinlande, S. 127.
- 26: Zender scheint zu seinem Vorgänger auf dem Lehrstuhl trotz verwandter Arbeitsgebiete (Heiligenverehrung!) zunächst wenig Kontakt gehabt zu haben. Er verfasste immerhin zwei Nachrufe: Karl Meisen 1891-1973, in: RhVjbl 38 (1974), S. IX-XII; Zender, Matthias, Karl Meisen, geb. 11. Oktober 1891, gestorben 22.3.1973, in: Zeitschrift für Volkskunde 69 (1973), S. 325; Schrutka-Rechtenstamm, Volkskunde, S. 76, 84; Höpfner, Universität Bonn, S. 451. Auch Meisens Erstgutachten zu Zenders Habilitationsschrift lässt eine gewisse Distanz erkennen, UAB PF-PA 1153. Dagegen sprächen allerdings die Einstellung Zenders als Assistent 1945 beziehungsweise 1949 und sein Testat von 1947.
- 27: Neben Zender und Kyll war an dieser Sammeltätigkeit auch der aus dem Westerwald stammende Joseph Höffner beteiligt. Dies berichten sowohl Matthias Zender, Wiegelmann, Nachruf, S. 261-262, als auch Joseph Kardinal Höffner, freundliche Mitteilung von Toni Diederich, Bonn.
- 28: Schrutka-Rechtenstamm, Volkskunde, S. 74-76, 78-79; Nikolay-Panter, Vierteljahrsblätter, S. 193-194; Zender, Matthias, Josef Müller 1875-1945, in: Bonner Gelehrte, S. 120-123; Zender, Wörterbuch.
- 29: Schrutka-Rechtenstamm, Volkskunde, S. 72; Nikolay-Panter, Vierteljahrsblätter, S. 194-195; Höpfner, Universität Bonn, S. 450-451; Zender, Matthias, Adolf Bach 70 Jahre alt, in: Zeitschrift für Volkskunde 56 (1960), S. 91-92; Zender, Matthias, Adolf Bach 80 Jahre, in: Rheinische Heimatpflege 7 (1970), S. 100; Zender, Matthias, Nachruf Adolf Bach, in: RhVjbl 37 (1973), S. IX-XVI. Zenders Nachruf erwähnt Bachs NS-Vergangenheit, macht aber auch seine 40-jährige persönliche Verbundenheit mit dem Verstorbenen deutlich. Unkritischer dagegen das von Zender und Steinbach unterzeichnete Vorwort zur zweibändigen Festschrift für Bach (RhVjbl 20-21, 1955-1956).
- 30: Schirrmacher, Volkstumsbegriff; Betz, Werner, Hans Naumann (1886-1951), in: Bonner Gelehrte, S. 129-133; Schrutka-Rechtenstamm, Volkskunde, S. 77: „hat für die Entwicklung der Volkskunde an der Bonner Universität […] keine besondere Bedeutung.“ Ähnlich Schirrmacher, Volkstumsbegriff, S. 177, 486. So ganz stimmt das allerdings nicht, denn von 1934 bis 1935 gab Naumann gemeinsam mit Karl Meisen fünf Hefte der einführenden Reihe „Rheinisches Volkstum“ heraus, die sich unter anderem mit der Volksüberlieferung, dem Volkslied, dem Volksbrauch und der Familienkunde befassen.
- 31: Schrutka-Rechtenstamm, Volkskunde, S. 77, 80-84; Gansohr-Meinel Landesstelle, S. 299-301; Höpfner, Universität Bonn, S. 448-456.
- 32: UAB Kleinere Slg., Nr. 298; Lejeune, Matthias Zender, zitiert S. 131-132 dessen Begründung „weil dies für alle Staatsangestellten Pflicht war.“
- 33: Schirrmacher, Volkstumsbegriff, Band 2, S. 476, 489.
- 34: Die Personalakte Zenders kann hier nur kursorisch ausgewertet werden, UAB PA 11967 III.
- 35: UAB IGL 105.
- 36: Bonner Gelehrte, S. 42; UAB PA 1112; Gerken, Horst (Hg.), Catalogus Professorum, 1831-2006. Festschrift zum 175-jährigen Bestehen der Universität Hannover, Band 2, Hildesheim 2006, S. 70 (mit Verzeichnis seiner zahlreichen Veröffentlichungen). Für freundliche Hinweise danke ich Lars Nebelung, Universitätsarchiv Hannover.
- 37: RhVjbl 9 (1939), S. 191; Nikolay-Panter, Vierteljahrsblätter, S. 196. Leider ist nur die Akte „M-Z“ der Korrespondenz um die Herausgabe der Vierteljahrsblätter 1937-1944 erhalten, UAB IGL 104. Darin befinden sich mehrere Briefe von und an Zender, aber auch ein Schreiben Edith Ennens vom 16.3.1942, in dem sie eine ganze Reihe von ausstehenden Rezensionen anmahnte.
- 38: Verzeichnis der Rezensionen bei Hagen, Ursula, „Verzeichnis der Schriften Matthias Zenders“ in seiner Festschrift, Band 2, S. 1239-1256, hier S. 1248-1249.
- 39: Overbeck, Hermann [u. a.] (Hg.), Saar-Atlas, 2. Auflage, Gotha 1934, S. 70-71, Zitat S. 71.
- 40: RhVjbl 3 (1933), S. 143-146, 4 (1934), S. 219-221, 11 (1941), S. 210-214.
- 41: RhVjbl 9 (1939), S. 296-297. Zu Wilmotte vgl. Ditt, Kulturraumforschung, S. 105; Beyen, Marnix, Eine lateinische Vorhut mit germanischen Zügen. Wallonische und deutsche Gelehrte über die germanische Komponente in der wallonischen Geschichte und Kultur (1900-1940), in: Dietz/Gabel/Tiedau, Griff, Band 1, S. 354-357, 362-364.
- 42: ALVR 4719; Lejeune, Zender, S. 133. Lejeune berichtet S. 132 weiter, die Hochschule für Lehrerinnenbildung in Koblenz habe wegen einer Beschäftigung oder eines Lehrauftrages angefragt, worauf Zender gar nicht reagiert habe. Kater, Michael H., Das „Ahnenerbe“ der SS 1935–1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches, 3. Auflage, München 2001, S. 69; Gansohr-Meinel, Landesstelle, S. 298-299.
- 43: Freundlicher Hinweis von Wolfgang Zender.
- 44: Höpfner, Bonn, S. 684-685; Höpfner, Universität Bonn, S. 450.
- 45: Die geht aus einem Brief Apffelstaedts an Matthes Ziegler vom 30.4.1938 hervor: „[…] da die in Bonn in der Volkskunde tätigen Herren […] nicht zur Debatte stehen“, ALVR 11057.
- 46: ALVR 11228.
- 47: Triffaux, Sprachverein, S. 129.
- 48: ALVR 4719.
- 49: ALVR 4682, 4717-4718.
- 50: ALVR 4718.
- 51: ALVR 4682.
- 52: UAB PA 11967 III, fol. 34. 1941 verfasste der erkrankte Josef Müller eine Art Nachlassregelung für die Vollendung des Rheinischen Wörterbuches. Darin schlug er als potentielle Nachfolger an erster Stelle Zender und an zweiter Dittmaier vor, Archiv Rheinisches Wörterbuch.
- 53: UAB PA 11967 III, fol. 45.
- 54: UAB PA 11967 III, fol. 67. Auf fol. 73 findet sich der Vermerk, dass Zender 1942 mit dem Kriegsverdienstkreuz II. Klasse ausgezeichnet wurde.
- 55: Hinweis von Wolfgang Zender.
- 56: Vgl. – neben den einschlägigen biographischen Artikeln – Ditt, Kulturraumforschung; Ditt, Karl, Franz Petri und die Geschichte der Niederlande: Vom germanischen Kulturraum zur Nation Europas, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 118 (2005), S. 169-187; Ditt, Karl, Die Politisierung der Kulturraumforschung im Dritten Reich. Das Beispiel Franz Petri, in: Dietz/Gabel/Tiedau, Griff, Band 2, S. 927-944; Tiedau, Franz Petri.
- 57: Die Universität hatte in der Zwischenzeit Heinrich Dittmaier als Vertreter eingestellt und die Zahlungen an Zender vom 1.10.1946 bis zum 31.10.1949 unterbrochen, so dass seine Frau mit ihrem Lehrerinnengehalt die Familie ernährte. 1953 erfolgte eine Gehaltsnachzahlung.
- 58: Lejeune, Matthias Zender; Wolfgang Zender danke ich für die Einsicht in dieses Schlüsseldokument, das aber im Rahmen dieser Studie unberücksichtigt bleibt.
- 59: Lejeune, Matthias Zender. Über Zenders Tätigkeit in Arlon bereitet Wolfgang Zender eine größere Untersuchung vor, so dass dieses Thema hier nicht näher vertieft werden soll. Vgl. Lejeune, Kulturbeziehungten, S. 106-118, 231-233, 248-249; Triffaux, Jean-Marie, Combats pour la langue dans le pays d'Arlon aux XIXe et XXe siècles. Une minorité oubliée? Arlon 2002, S. 313-390; Triffaux, Sprachverein.
- 60: Von den Zeugnissen haben sich Abschriften im Nachlass Matthias Zenders erhalten. Die Originale wurden den belgischen Behörden vorgelegt. Ob alle Zeugnisse überliefert sind, ist ebenso unklar wie, ob das deutlich später von Franz Petri ausgefertigte in diesen Kontext gehört. Für die Überlassung der Dokumente danke ich Wolfgang Zender.
- 61: Bach schrieb in einem Fragebogen, er sei 1945 „aus Straßburg amtsverdrängt worden“, an anderer Stelle gibt er die „amtslose Zeit“ vom 9.5.1945 bis zum 30.9.1948 an. Danach wurde er wegen seines Augenleidens in den Ruhestand versetzt, 1954 dann emeritiert und zum Lehrbeauftragten ernannt, UAB PA 224; PF-PA 653. Bach hatte bereits 1931 den abwesenden Steinbach als Direktor vertreten, ALVR 11061. 1940 schloss die Pädagogische Hochschule in Bonn, Steinbach suchte eine neue Beschäftigung für Bach, der ihn in Bonn vertreten sollte, was dieser zum Beispiel 1942 auch tat, ALVR 11057.
- 62: Sicherlich hatte Zender dabei stets auch die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in seinem Heimatkreis Bitburg vor Augen, dazu ausführlich die leider ungedruckte Staatsexamensarbeit von Grasediek, Zentrumspartei.
- 63: Einzelheiten bei Ditt, Kulturraumforschung, S. 131-136; Rusinek, Traditionen, S. 1154; Schärer, Martin, Deutsche Annexionspolitik im Westen. Die Wiedereingliederung Eupen-Malmedys im Zweiten Weltkrieg, Bern 1978, S. 32, 108; Fahlbusch, Deutschtumspolitik, S. 645.
- 64: Ditt, Kulturraumforschung, S. 149-153; Nikolay-Panter, Marlene, Der Steinbach-Lehrstuhl an der Universität Bonn und seine Wiederbesetzung (1960-1962), in: Das Heute hat Geschichte. Forschungen zur Geschichte Düsseldorfs, des Rheinlandes und darüber hinaus. Festschrift für Clemens von Looz-Corswarem, Essen 2012, S. 279-295; Janssen, Institut.
- 65: Die subtilen Möglichkeiten, „politisch unzuverlässige“ (katholische) Zeitgenossen im täglichen Leben zu schikanieren, zeigt anschaulich Hehl, Ulrich von, Die katholische Kirche im Rheinland während des Dritten Reiches. Kirchenpolitische und alltagsgeschichtliche Aspekte, in: RhVjbl 59 (1995), S. 249-270, hier S. 164-267. Wie sehr auch die (katholische) Volkskunde überwacht wurde, zeigt das Beispiel des Kaplans Benedikt Caspar, der 1939 in seinem Buch „Rund um den schiefen Turm“ eine religiöse Volkskunde der Stadt Mayen veröffentlichte und darin die Veränderungen des „Dritten Reichs“ zur Verärgerung der Machthaber vollständig ignorierte, vgl. den Bericht der SD-Außenstelle Koblenz bei Brommer, Peter, Das Bistum Trier im Nationalsozialismus aus der Sicht von Partei und Staat, Mainz 209, Nr. 217.
- 66: Persch/Schneider, Beharrung, S. 393-395 (zum Priesterseminar), 82, 97, 182 (Hansen), 187, 735 (Backes); Der Weltklerus der Diözese Trier seit 1800, Trier 1941, S. 37, 40, 142; Handbuch des Bistums Trier, 20. Auflage Trier 1962, S. 84-85, 92-93, 95; 22. Auflage 1991, Teil 3, S. 581-582 (zu Hansen); Bischöflichen Priesterseminar Trier. Vorlesungs-Verzeichnis. Winter-Semester 1947-1948; Theologische Fakultät, Trier. Vorlesungsverzeichnis für das Sommer-Semester 1951.
- 67: BBKL, Band 20 (2002), Sp. 85-86; Nosbüsch, Johannes, Ein Mann aus Wettlingen. Prälat Professor Dr. Wilhelm Bartz zum Gedenken, in: Landkreis Bitburg-Prüm. Heimatkalender 1984, S. 58-64 (Nosbüsch war Schüler von Bartz und erwähnt das Geschichtenerzählen seiner Mutter); Reinhardt, Klaus, Er sprach früh vom Volk Gottes, in: Große Persönlichkeiten der Theologischen Fakultät, Trier, Trier 2011, S. 10-12.
- 68: Schützeichel, Heribert, Schrittmacher der Ökumene, in: Große Persönlichkeiten, S. 40-41; Monz, Lexikon, S. 15-16; Neu, Bitburger Persönlichkeiten, Band 2, S. 99-103.
- 69: Schwall, Gymnasium, S. 336, 338.
- 70: Löffler war seit 1924 als Ministerialrat Leiter der Schulabteilung beim Kultusministerium in Stuttgart. Er setzte sich besonders für das deutsche Schulwesen im Ausland ein. Hier ergeben sich Berührungspunkte mit der Arbeit des VDA. Auch nach seiner Pensionierung 1951 war er bei der Kulturministerkonferenz und für das Goethe-Institut tätig. Einige Hinweise bei Dietz/Gabel/Tiedau, Griff, Band 2, S. 617, 1030.
- 71: Tiedau, Franz Petri, S. 470; Schöttler, Westforschung, S. 212.
- 72: Fahlbusch hat dieses Netzwerk recht treffend charakterisiert: „Die Teilnehmer selbst hatten, sofern sie die bürokratische Hürde der Entnazifizierung überwunden hatten – und es gibt keinen Zweifel, dass angesichts der Persilscheine ehemaliger Kollaborateure keiner der Volkswissenschaftler diese nicht überstand – sich durch Nachwuchskräfte ergänzt.“ Fahlbusch, Deutschtumspolitik, S. 645. Nikolay-Panter, Marlene, Kontinuität und Wandel. Die Arbeitsgemeinschaft für westdeutsche Landes- und Volksforschung in Bonn (1949/50-1969), in: Thüringische und Rheinische Forschungen: Bonn – Koblenz – Weimnar – Meiningen. Festschrtift für Johannes Mötsch zuim 65. Geburtstag, Leipzig 2014, S. 502-525.
- 73: Dietz/Gabel/Tiedau, Griff, Band 2, S. 610, 614, 645-646, 1088; Kartheuser, Jahre; Haar/Fahlbusch, Handbuch, S. 376, 470, 474 (!), 652; Lejeune, Kulturbeziehungen, S. 112, 115, 126, 132, 134, 142, 151-152. An neueren Arbeiten zur Biographie: Brüll, Christoph, Franz Thedieck (1900-1995). „Zeitgenossen des Jahrhunderts“, in: Historisch-politische Mitteilungen 20 (2013), S. 341-370 (http://www.kas.de/upload/ACDP/HPM/HPM_20_13/21-Bruell.pdf); Brüll, Christoph, Vom „Reichsbeauftragten für Eupen-Malmedy“ zum Staatssekretär der Regierung Adenauer: Franz Thedieck (1900-1995), in: Brüll, Christoph [u. a.] (Hg.), Eine ostbelgische Stunde Null? Eliten aus Eupen und Malmedy vor und nach 1944, Brüssel 2013, S. 87-105; Brüll, Verhältnis.
- 74: Bundesarchiv Koblenz, N 11/1174/57. Den Hinweis verdanke ich Brüll, Verhältnis, Anm. 45.
- 75: Streit war von 1963 bis 1969 Präsident des Verwaltungsgerichts Köln.
- 76: UAB PA 11967 III, fol. 110-114. Die Entnazifizierungsbescheinigung Zenders in UAB PA 11967 III, fol. 86.
- 77: RhVjbl 8 (1938), S. 165-178. Zur Aachener Tagung Fahlbusch, Deutschtumspolitik, S. 626.
- 78: UAB IGL 35.
- 79: UAB IGL 105; Rusinek, Traditionen, S. 1184; Beyen, Vorhut, S. 365.
- 80: UAB IGL 105.
- 81: Rusinek, Traditionen, S. 1184.
- 82: RhVjbl 21 (1956), S. 97-109; Hermel, Verzeichnis, S. 195.
- 83: Wobei Zender durchaus 1940 in einem gemeinsam mit Steinbach verfassten Gutachten zu dem Ergebnis kam, das Endziel jeder deutschen Kulturpolitik müsse 'die volle Wiedereindeutschung dieser alten volksdeutschen Gebiete sein.' Lejeune, Westen, S. 530-531.
- 84: Die Heimat Eupen-Malmedy 1 (1936), S. 18-19, 30-31, 37-38.
- 85: RhVjbl 7 (1937), S. 25-46, S. 37 wird die „rassische Verschiedenheit“ zur Begründung unterschiedlicher Erzählertemperamente bemüht.
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.
Schmid, Wolfgang, Matthias Zenders Sagensammlung, der Eifelverein, das Bonner Institut für geschichtliche Landeskunde und die „Westforschung“, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/matthias-zenders-sagensammlung-der-eifelverein-das-bonner-institut-fuer-geschichtliche-landeskunde-und-die-westforschung/DE-2086/lido/5acb2f896ad4c1.25732577 (abgerufen am 10.05.2024)